45.000 Fahrgäste pro Spitzenstunde in Zürich erwartet
-
Vielfahrer
- Örtlicher Betriebsleiter
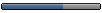
- Beiträge: 4880
- Registriert: So 1. Aug 2010, 13:32
- Wohnort: Tübingen Weststadt
45.000 Fahrgäste pro Spitzenstunde in Zürich erwartet
Auf der Gäubahn wird ja zukünftig mit dem stündlichen IC südlich von Horb ein Sitzplatzangebot von ca. 500 Plätzen pro Stunde und Richtung angeboten. Eine der stärksten Strecken in unserer Gegend ist der Abschnitt Hinterzarten - Freiburg. Dem Vernehmen nach müssen dort in der Spitzenstunde 2.000 Personen pro Richtung befördert werden!
Heute nun las ich in der NZZ einen höchst interessanten Artikel zur Situation in der Schweiz. Der Korrenspondent Stefan Hotz führt dazu aus:
Auf der Bahnverbindung Zürich - Winterthur wird die Nachfrage bis Ende des nächsten Jahrzehnts um 75% steigen. Die SBB wollen bis 2019 technisch das Maximum aus der Strecke herausholen. Dann hilft nur noch der Brüttener Tunnel.
Wie profitieren Bahnkunden im Raum Zürich vom ersten Ausbauabschnitt bis 2025 im Rahmen von Fabi? Über diese Bundesvorlage für die Finanzierung und den Ausbau von Bahninfrastruktur wird voraussichtlich im Februar abgestimmt. Die korrekte Antwort lautet: durch den Halbstundentakt zwischen Zürich und Chur sowie zwischen Sargans und Buchs im Rheintal und dank längeren Zügen auf der Südostbahn.
Das sind nicht die dringendsten Engpässe aus Zürcher Sicht. Mit der Eröffnung der Durchmesserlinie und den 4. Teilgergänzungen der S-Bahn wird jedoch bis Ende 2018 das Angebot auf dem Zürcher Schienennetz erheblich verbessert. Dann ist der Halbstundentakt flächendeckend Realität. Außerdem hat der Zürcher Regierungsrat erreicht, dass die Projektierung des Brüttener Tunnels und des Bahnhofsausbaus am Stadelhofen auf 4 Gleise verbindlich Teil der Fabi-Vorlage ist. 2017/18 wird entschieden, ob die beiden Vorhaben bis 2030 gebaut werden.
Tatsache ist, dass ab 2019 eine Investitionspause folgt. Die Zunahme der Pendlerströme wird jedoch weitergehen. In einem kleinen Seminar haben die Veranwortlichen der SBB, namentlich Philippe Gauderon, Leiter Infrastruktur, und daria Martiononi, Leiterin Netzentwicklung, am Freitag erläutert, wie die Verkehrszunahme bewältigt werden soll. Ort war nicht von ungefähr Winterthur. Zwischen Zürich und der Eulachstadt wird die Nachfrage am meisten steigen, gegenüber 2007 bis 2030 auf das Doppelte. Das ist in absoluten Zahlen (Spitzenbelastung knapp 14.000 Fahrgäste/Stunde!) und prozentual weit mehr als auf anderen Bahnkorridoren. Grund ist, dass sich auf dieser Achse der Pendelverkehr aus mehreren Richtungen - St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen - überlagert. Um zu reagieren, stehen den SBB immerhin und zugesichert rund 750 Millionen Franken zur Verfügung.
Die erste Verbesserung, die Überwerfung Hürlistein, ist Ende Jahr bereit. Die Entflechtung an der Abzweigung Flughafenlinie bei Lindau und ein Überholgleis für Güterzüge in Winterthur bringen mehr Stabilität im Fahrplan. Mit Weichen für den Spurwechsel, dem 4. Gleis Hürlistein - Effretikon, das im Bau ist, und einer Reduktion der Zugfolgezeiten kann ab 2016 die Kapazität auf den zwei Gleisen zwischen Effretikon und Winterthur von heute 500 auf 570 Züge im Tag erhöht werden. Der größte Schritt folgt Ende 2018 mit Entflechtungen in Kloten, Anpassungen in Winterthur und kürzeren Zugfolgezeiten auch zwischen Flughafen und Effretikon. Danach können im Tag 670 Züge den verbleibenden Doppelspurabschnitt passieren, was laut Martinoni das planbare Maximum ist.
Für eine weitere Leistungssteigerung ist der Bau des Brüttener Tunnels für rund 2,2 Milliarden Franken unumgänglich. Der Entscheid für die unterirdische Variante sei noch nicht gefallen, erklärte Martinoni. Für die Verantwortlichen der SBB ist der Tunnel jedoch gesetzt, zumal der Projektierungkredit in Fabi explizit für diesen Zweck reserviert ist. Der Ausbau der heutigen Strecke auf 4 Spuren würde insgesamt nicht wesentlich weniger kosten, wurde erklärt. Der Brüttener Tunnel habe den Vorteil, dass der Bau den Bahnbetrieb nicht störe.
Bis mindestens 2030 bleibt ein Engpass, der in den Zügen spürbar wird. Gemäß SBB-Angaben kann bis 2019 der Anstieg der Passagierzahl gegenüber heute um etwa 20% aufgefangen werden. Bis 2025/30 wird die Nachfrage aber weiter um 45 bis 75 Prozent zunehmen. Da die SBB Bahnkunden zwischen Zürich und Winterthur bei einer Fahrzeit von rund 20 Minuten Sitzplätze anbieten wollen, entspricht die Differenz zum Angebot gemäß der Grafik (Anmerkung: die ich leider nicht einfügen kann) den Stehplätzen, die zu den Haupterkehrszeiten in Kauf zu nehmen sind.
Folgende Belastungszahlen (Verkehrsaufkommen in der Spitzenstunde (!)) enthält die Grafik:
Horgen - Zürich ca. 3.800 Pers./h
Zug - Zürich ca. 2.000 Pers./h
Affoltern a. A. - Zürich ca. 3.000 Pers./h
Dietikion - Zürich ca. 4.800 Pers./h
Regensdorf - Zürich ca. 2.000 Pers./h
Bülach - Zürich ca. 5.900 Pers./h
Winterthur - Zürich ca. 13.200 Pers./h
Uster/Wetzikon - Zürich ca. 7.000 Pers./h
Meilen - Zürich ca. 4.000 Pers./h
Mit der Schiene fahren also ca. 45.000 Pers./Spitzenstunde nach Zürich. Gigantisch. Das sind grob 20 mal mehr als wir im Höllental, das uns als Meßlatte dient.
Ich habe nur einmal ein Beförderungsvolumen von 2 Millionen Menschen gesehen, die binnen weniger Stunden befördert werden wollten, nämlich beim Silvesterfeuerwerk in Rio de Janeiro an der Copacabana, wo man zur Steuerung des Verkehrsaufkommens nur Fahrscheine kaufen kann, die für ein kleines Zeitfenster der U-Bahn-Linie gelten. Für PKW gilt eine komplette Sperrung. Tausende von Stadtbussen stehen in 4 Parallelstraßen zur Küstenstraße für den Rücktransport bereit.
In Zürich aber wird das Alltag sein. Das kann das System Bahn. Und hierzulande rollen schwach besetzte Züge und Busse (außerhalb der Verkehrsspitze versteht sich).
Viele Grüße vom Vielfahrer
Heute nun las ich in der NZZ einen höchst interessanten Artikel zur Situation in der Schweiz. Der Korrenspondent Stefan Hotz führt dazu aus:
Auf der Bahnverbindung Zürich - Winterthur wird die Nachfrage bis Ende des nächsten Jahrzehnts um 75% steigen. Die SBB wollen bis 2019 technisch das Maximum aus der Strecke herausholen. Dann hilft nur noch der Brüttener Tunnel.
Wie profitieren Bahnkunden im Raum Zürich vom ersten Ausbauabschnitt bis 2025 im Rahmen von Fabi? Über diese Bundesvorlage für die Finanzierung und den Ausbau von Bahninfrastruktur wird voraussichtlich im Februar abgestimmt. Die korrekte Antwort lautet: durch den Halbstundentakt zwischen Zürich und Chur sowie zwischen Sargans und Buchs im Rheintal und dank längeren Zügen auf der Südostbahn.
Das sind nicht die dringendsten Engpässe aus Zürcher Sicht. Mit der Eröffnung der Durchmesserlinie und den 4. Teilgergänzungen der S-Bahn wird jedoch bis Ende 2018 das Angebot auf dem Zürcher Schienennetz erheblich verbessert. Dann ist der Halbstundentakt flächendeckend Realität. Außerdem hat der Zürcher Regierungsrat erreicht, dass die Projektierung des Brüttener Tunnels und des Bahnhofsausbaus am Stadelhofen auf 4 Gleise verbindlich Teil der Fabi-Vorlage ist. 2017/18 wird entschieden, ob die beiden Vorhaben bis 2030 gebaut werden.
Tatsache ist, dass ab 2019 eine Investitionspause folgt. Die Zunahme der Pendlerströme wird jedoch weitergehen. In einem kleinen Seminar haben die Veranwortlichen der SBB, namentlich Philippe Gauderon, Leiter Infrastruktur, und daria Martiononi, Leiterin Netzentwicklung, am Freitag erläutert, wie die Verkehrszunahme bewältigt werden soll. Ort war nicht von ungefähr Winterthur. Zwischen Zürich und der Eulachstadt wird die Nachfrage am meisten steigen, gegenüber 2007 bis 2030 auf das Doppelte. Das ist in absoluten Zahlen (Spitzenbelastung knapp 14.000 Fahrgäste/Stunde!) und prozentual weit mehr als auf anderen Bahnkorridoren. Grund ist, dass sich auf dieser Achse der Pendelverkehr aus mehreren Richtungen - St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen - überlagert. Um zu reagieren, stehen den SBB immerhin und zugesichert rund 750 Millionen Franken zur Verfügung.
Die erste Verbesserung, die Überwerfung Hürlistein, ist Ende Jahr bereit. Die Entflechtung an der Abzweigung Flughafenlinie bei Lindau und ein Überholgleis für Güterzüge in Winterthur bringen mehr Stabilität im Fahrplan. Mit Weichen für den Spurwechsel, dem 4. Gleis Hürlistein - Effretikon, das im Bau ist, und einer Reduktion der Zugfolgezeiten kann ab 2016 die Kapazität auf den zwei Gleisen zwischen Effretikon und Winterthur von heute 500 auf 570 Züge im Tag erhöht werden. Der größte Schritt folgt Ende 2018 mit Entflechtungen in Kloten, Anpassungen in Winterthur und kürzeren Zugfolgezeiten auch zwischen Flughafen und Effretikon. Danach können im Tag 670 Züge den verbleibenden Doppelspurabschnitt passieren, was laut Martinoni das planbare Maximum ist.
Für eine weitere Leistungssteigerung ist der Bau des Brüttener Tunnels für rund 2,2 Milliarden Franken unumgänglich. Der Entscheid für die unterirdische Variante sei noch nicht gefallen, erklärte Martinoni. Für die Verantwortlichen der SBB ist der Tunnel jedoch gesetzt, zumal der Projektierungkredit in Fabi explizit für diesen Zweck reserviert ist. Der Ausbau der heutigen Strecke auf 4 Spuren würde insgesamt nicht wesentlich weniger kosten, wurde erklärt. Der Brüttener Tunnel habe den Vorteil, dass der Bau den Bahnbetrieb nicht störe.
Bis mindestens 2030 bleibt ein Engpass, der in den Zügen spürbar wird. Gemäß SBB-Angaben kann bis 2019 der Anstieg der Passagierzahl gegenüber heute um etwa 20% aufgefangen werden. Bis 2025/30 wird die Nachfrage aber weiter um 45 bis 75 Prozent zunehmen. Da die SBB Bahnkunden zwischen Zürich und Winterthur bei einer Fahrzeit von rund 20 Minuten Sitzplätze anbieten wollen, entspricht die Differenz zum Angebot gemäß der Grafik (Anmerkung: die ich leider nicht einfügen kann) den Stehplätzen, die zu den Haupterkehrszeiten in Kauf zu nehmen sind.
Folgende Belastungszahlen (Verkehrsaufkommen in der Spitzenstunde (!)) enthält die Grafik:
Horgen - Zürich ca. 3.800 Pers./h
Zug - Zürich ca. 2.000 Pers./h
Affoltern a. A. - Zürich ca. 3.000 Pers./h
Dietikion - Zürich ca. 4.800 Pers./h
Regensdorf - Zürich ca. 2.000 Pers./h
Bülach - Zürich ca. 5.900 Pers./h
Winterthur - Zürich ca. 13.200 Pers./h
Uster/Wetzikon - Zürich ca. 7.000 Pers./h
Meilen - Zürich ca. 4.000 Pers./h
Mit der Schiene fahren also ca. 45.000 Pers./Spitzenstunde nach Zürich. Gigantisch. Das sind grob 20 mal mehr als wir im Höllental, das uns als Meßlatte dient.
Ich habe nur einmal ein Beförderungsvolumen von 2 Millionen Menschen gesehen, die binnen weniger Stunden befördert werden wollten, nämlich beim Silvesterfeuerwerk in Rio de Janeiro an der Copacabana, wo man zur Steuerung des Verkehrsaufkommens nur Fahrscheine kaufen kann, die für ein kleines Zeitfenster der U-Bahn-Linie gelten. Für PKW gilt eine komplette Sperrung. Tausende von Stadtbussen stehen in 4 Parallelstraßen zur Küstenstraße für den Rücktransport bereit.
In Zürich aber wird das Alltag sein. Das kann das System Bahn. Und hierzulande rollen schwach besetzte Züge und Busse (außerhalb der Verkehrsspitze versteht sich).
Viele Grüße vom Vielfahrer
- Villinger
- Fahrdiensleiter
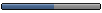
- Beiträge: 3288
- Registriert: Sa 18. Okt 2008, 20:25
- Wohnort: Villingen im Schwarzwald
- Alter: 29
Re: 45.000 Fahrgäste pro Spitzenstunde in Zürich erwartet
Während die Schweizer das Potenzial sehen und versuchen, es durch ein verbessertes Angebot erst richtig rauszuholen, streicht die DB unrentable Strecken derart, dass es weit davon entfernt ist, attraktiv zu sein. Ich erinnere nochmals daran, dass der FV auf der Gäubahn Anfang 2012 theoretisch vor dem Aus gestanden hätte, wäre die SBB mit ihrem Veto nicht dazwischen gegangen.
Mal sehen, ob die Politik nach gut 20 Jahren Bahnreform endlich bemerkt, dass eigenwirtschaftlicher Fernverkehr an vielen Stellen nicht funktioniert.
Mal sehen, ob die Politik nach gut 20 Jahren Bahnreform endlich bemerkt, dass eigenwirtschaftlicher Fernverkehr an vielen Stellen nicht funktioniert.
 Aus dem Fridinger wurde der Villinger
Aus dem Fridinger wurde der Villinger 
-
wolfgang65
- Rangierhelfer
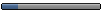
- Beiträge: 792
- Registriert: Di 8. Jan 2008, 20:58
- Wohnort: Villingen
Re: 45.000 Fahrgäste pro Spitzenstunde in Zürich erwartet
Die Vergleiche hinken aber schon etwas - Der Raum Zürich ist eine Gegend mit vielen Staus und nicht gerade perfekt funktionierender Straße. Also die optimale Ecke um Schienenverkehr gut aufzuziehen - macht man das halbwegs vernünftig ist der Erfolg da.
Vergleiche mit der Gäubahn auf deutscher Seite sind da wirklich wenig sinnvoll. Hier gibts kaum Staus und schnellere Straßen, dazu noch weniger Bevölkerung - egal was man tut, das wird nie ähnlich erfolgreich.
Das soll das Schweizer System nicht schlecht machen - wirklich nicht - aber in erster Linie zählt das Umfeld und nicht ein noch so gutes bahntechnisches Umfeld. Eine Bahn kann in ländlicher Region dem Auto nie das Wasser reichen. Die Bahn ist ein optimales Verkehrsmittel für Massen, aber diese müssen auch da sein....
Grüße
Wolfgang
Vergleiche mit der Gäubahn auf deutscher Seite sind da wirklich wenig sinnvoll. Hier gibts kaum Staus und schnellere Straßen, dazu noch weniger Bevölkerung - egal was man tut, das wird nie ähnlich erfolgreich.
Das soll das Schweizer System nicht schlecht machen - wirklich nicht - aber in erster Linie zählt das Umfeld und nicht ein noch so gutes bahntechnisches Umfeld. Eine Bahn kann in ländlicher Region dem Auto nie das Wasser reichen. Die Bahn ist ein optimales Verkehrsmittel für Massen, aber diese müssen auch da sein....
Grüße
Wolfgang
-
Vielfahrer
- Örtlicher Betriebsleiter
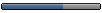
- Beiträge: 4880
- Registriert: So 1. Aug 2010, 13:32
- Wohnort: Tübingen Weststadt
Re: 45.000 Fahrgäste pro Spitzenstunde in Zürich erwartet
Hallo Fridinger,
ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Eigenwirtschaftlicher Fernverkehr etwa auf der Strecke Mannheim - Frankfurt oder an anderen Stellen kann sich durchaus lohnen. Gerade auf der Gäubahn wird nun ja ab Dezember 2017 der Versuch unternommen, mit einer neuen Strategie eigenwirtschaftlich jede Stunde einen Zug verkehren zu lassen. Das muss und wird sich für die DB rechnen (auf der Basis des IC-Tarifs = B-Tarif). Das Land jedenfalls bestellt keinen Zug mehr im Abschnitt südlich von Rottweil bis Singen bei DB-Regio, allenfalls ein Fahrrad-Express, weil dieser Markt nur mit Fernverkehrszügen nicht ausreichend bedienbar ist.
Zufällig hatte ich heute die Gelegenheit, u.a. zwei Managern von DB-Fernverkehr über die Gäubahn zuzuhören. Mein Eindruck: Von denen kann man noch sehr viel lernen. Auf alle Fälle haben die viel mehr drauf als so manche Verfechter von "Kleckern statt Klotzen" oder wie das hin und wieder bei Pro Bahn hieß (500 Mio. wollten manche alleine in der Gegend von Tuttlingen ausgeben...). Die setzen jetzt 300 Millionen für neue Fahrzeuge und müssen und werden das erwirtschaften. Also verstehen sie ihr Geschäft!
Was uns gänzlich von der Schweiz unterscheidet, das sind die Rahmenbedingungen, z.B. die Investitionen in den Schienenverkehr pro Einwohner. Dafür kann aber DB-Fernverkehr nichts - oder? Immerhin, das Land unternimmt mit seiner Bereitschaft, die Differenz zwischen Verbundtarifen und dem B-Tarif auszugleichen, einen richtigen und logischen Schritt. Ich rechne damit, dass zukünftig der halbe Stuttgarter Raum an schönen Wochenenden sich für billiges Geld (BW-Ticket) an den Bodensee fahren lassen wird und dass es dabei Kapazitätsprobleme geben wird. Aber dann wird es von interessierter Seite wohl wieder heißen, die können das halt nicht....
Viele Grüße vom Vielfahrer
ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Eigenwirtschaftlicher Fernverkehr etwa auf der Strecke Mannheim - Frankfurt oder an anderen Stellen kann sich durchaus lohnen. Gerade auf der Gäubahn wird nun ja ab Dezember 2017 der Versuch unternommen, mit einer neuen Strategie eigenwirtschaftlich jede Stunde einen Zug verkehren zu lassen. Das muss und wird sich für die DB rechnen (auf der Basis des IC-Tarifs = B-Tarif). Das Land jedenfalls bestellt keinen Zug mehr im Abschnitt südlich von Rottweil bis Singen bei DB-Regio, allenfalls ein Fahrrad-Express, weil dieser Markt nur mit Fernverkehrszügen nicht ausreichend bedienbar ist.
Zufällig hatte ich heute die Gelegenheit, u.a. zwei Managern von DB-Fernverkehr über die Gäubahn zuzuhören. Mein Eindruck: Von denen kann man noch sehr viel lernen. Auf alle Fälle haben die viel mehr drauf als so manche Verfechter von "Kleckern statt Klotzen" oder wie das hin und wieder bei Pro Bahn hieß (500 Mio. wollten manche alleine in der Gegend von Tuttlingen ausgeben...). Die setzen jetzt 300 Millionen für neue Fahrzeuge und müssen und werden das erwirtschaften. Also verstehen sie ihr Geschäft!
Was uns gänzlich von der Schweiz unterscheidet, das sind die Rahmenbedingungen, z.B. die Investitionen in den Schienenverkehr pro Einwohner. Dafür kann aber DB-Fernverkehr nichts - oder? Immerhin, das Land unternimmt mit seiner Bereitschaft, die Differenz zwischen Verbundtarifen und dem B-Tarif auszugleichen, einen richtigen und logischen Schritt. Ich rechne damit, dass zukünftig der halbe Stuttgarter Raum an schönen Wochenenden sich für billiges Geld (BW-Ticket) an den Bodensee fahren lassen wird und dass es dabei Kapazitätsprobleme geben wird. Aber dann wird es von interessierter Seite wohl wieder heißen, die können das halt nicht....
Viele Grüße vom Vielfahrer
- Villinger
- Fahrdiensleiter
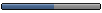
- Beiträge: 3288
- Registriert: Sa 18. Okt 2008, 20:25
- Wohnort: Villingen im Schwarzwald
- Alter: 29
Re: 45.000 Fahrgäste pro Spitzenstunde in Zürich erwartet
Logisch - Auf den Rennstrecken, Magistralen und den gut ausgelasteten Strecken läuft es für DB Fernverkehr natürlich gut, keine Frage. Aber schau mal auf die abgelegenen Regionen, wie Nürnberg-Dresden, Berlin-Stralsund, Hamburg-Westerland, Koblenz-Trier oder München-Oberstorf? Dort sind früher überall entweder InterRegios (vertacket) oder richtige Fernzüge gefahren, die alle innerhalb der 'Privat-DB' entweder auf einige IC-Züge zusammengeschmolzen oder ganz aufgegeben wurden. Berlin-Stralsund wird noch durch ein paar IC-Züge bedient sowie ein ICE-Zugpaar (dient mehr dem Alibi), die größtenteils dem Touristenverkehr dienen und deshalb auch nur im Sommer fahren, in etwa das gleiche mit Hamburg-Westerland. Nürnberg-Dresden waren die defekten ICE-TD schuld, wo über lokbespannte IC-Ersatzzüge dann auf die jetzt noch fahrenden 612er (die gab es mal in weißer ICE-Optik!) umgestiegen wurde. Koblenz-Trier wurde wegen mangelder Auslastung auch auf zwei Alibi-Zugpaare geschrumpft und bei München-Oberstorf hat die BEG übernommen und den Alex-Zug ausgeschrieben und - Wen wunderts - als Dank für die Einstellung des IR natürlich nicht der DB vermacht. In Niedersachsen wird ja schon ab Dezember das Nahverkehr-Integrationskonzept, das auf der Gäubahn ab 2017 greifen soll, zwischen Hannover und Norddeich eingeführt, dort hatte man bisher auch einige IC-Zugpaare für den Tourismus zur Nordseeküste gefahren.
Moment: Hieß es nicht, dass das BW-Ticket im künftigen RIC (RegioInterCity oder so) nicht gilt?
Moment: Hieß es nicht, dass das BW-Ticket im künftigen RIC (RegioInterCity oder so) nicht gilt?
 Aus dem Fridinger wurde der Villinger
Aus dem Fridinger wurde der Villinger 
- Hannes
- Weichensteller
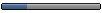
- Beiträge: 1083
- Registriert: Di 11. Mär 2008, 22:50
- Alter: 35
Re: 45.000 Fahrgäste pro Spitzenstunde in Zürich erwartet
Ich halte von der strikten Trennung zwischen Regional- und Fernverkehr nichts, aber das hat halt mit dem deutschen Föderalismus zu tun. Sie schadet in meinen Augen gerade den schwachen Strecken und verschiebt ja in nicht unerheblichen Ausmaß die Auslastung von den Fernzügen in die Regionalzüge mit den bekannten Problemen. In Österreich sieht man es ja abseits der großen Strecken auch, dass die IC/EC vom Haltabstand auch mal eher ein Regionalexpress sind, aber somit lässt sich eben auf Strecken, auf denen eh nix mit Schnellfahren ist, die Auslastung steigern und es müssen nicht zwei halbleere Züge durch die Gegend fahren.
Mal schauen, ob Dr. Breimeiers Einschätzung zutrifft, dass wir in ein paar Jahren einen auf Bundesebene ausgeschriebenen Fernverkehr haben.
Zu Nürnberg-Dresden: Erst gab es die 612er in Fernverkehrsfarben, dann die lokbespannten IC, bevor dann 2006 jetzige Fahrplankonzept umgesetzt wurde, das wiederum diesen Dezember Geschichte sein wird und durch eines mit weniger Direktverbindungen ersetzt wird. Da kann ich mich dann entscheiden, ob ich lieber 4 h im 612er rumgurke oder länger brauche und ab Hof im Dosto hocke... :ahnung:
An der Ausschreibung der ex-IR-Verkehre in Bayern wird sich die DB sicherlich auch beworben haben und da gelten für alle die gleichen Regeln. Es ist höchstens die Frage, wie die Bedingungen gestaltet werden. Dass die DB, weil sie den IR eingestellt hat, nicht dessen Ersatzverkehre gewinnen darf, halte ich für eine zu einfache These.
In den Gäubahn-IC im Übergangskonzept gilt der Nahverkehrstarif und der kennt nun mal auch ein Ba-Wü-Ticket, warum sollte es da nicht unter den bekannten Bedingungen gelten? Nach Singen kommt man ja sonst nicht mehr im reinen Regionalverkehr.
Grüße, Hannes
Mal schauen, ob Dr. Breimeiers Einschätzung zutrifft, dass wir in ein paar Jahren einen auf Bundesebene ausgeschriebenen Fernverkehr haben.
Zu Nürnberg-Dresden: Erst gab es die 612er in Fernverkehrsfarben, dann die lokbespannten IC, bevor dann 2006 jetzige Fahrplankonzept umgesetzt wurde, das wiederum diesen Dezember Geschichte sein wird und durch eines mit weniger Direktverbindungen ersetzt wird. Da kann ich mich dann entscheiden, ob ich lieber 4 h im 612er rumgurke oder länger brauche und ab Hof im Dosto hocke... :ahnung:
An der Ausschreibung der ex-IR-Verkehre in Bayern wird sich die DB sicherlich auch beworben haben und da gelten für alle die gleichen Regeln. Es ist höchstens die Frage, wie die Bedingungen gestaltet werden. Dass die DB, weil sie den IR eingestellt hat, nicht dessen Ersatzverkehre gewinnen darf, halte ich für eine zu einfache These.
In den Gäubahn-IC im Übergangskonzept gilt der Nahverkehrstarif und der kennt nun mal auch ein Ba-Wü-Ticket, warum sollte es da nicht unter den bekannten Bedingungen gelten? Nach Singen kommt man ja sonst nicht mehr im reinen Regionalverkehr.
Grüße, Hannes
"Deutsche siegen im Fußball, aber bei der Bahn ist täglich Cordoba."
ÖBB-Chef Christian Kern in der Kronenzeitung vom 8.11.14
ÖBB-Chef Christian Kern in der Kronenzeitung vom 8.11.14
-
Vielfahrer
- Örtlicher Betriebsleiter
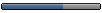
- Beiträge: 4880
- Registriert: So 1. Aug 2010, 13:32
- Wohnort: Tübingen Weststadt
Re: 45.000 Fahrgäste pro Spitzenstunde in Zürich erwartet
Hallo,
der gestrige Beitrag in der NZZ hat kontroverse Reaktionen dort ausgelöst. Auf einer ganzen Seite dazu kann man heute Denkanstöße zur Verkehrspolitik lesen. Einer kommt dabei zum Fazit, das Fahren mit der Eisenbahn sei zu günstig. So würde der Eigenwirtschaftlichkeitsgrad der Eisenbahnen in der Schweiz gerade noch 41% betragen, während er vor 20 Jahren noch bei 64,5% gelegen habe. Einem Nettoertrag von 7 Mrd. SFr. sünden Transferzahlungen der öffentlichen Hand von 10,2 Mrd. SFr. gegenüber. Damit würden Bahnkunden faktisch 60% Rabatt gewährt. Gründe dafür werden darin gesehen, dass man ie Konsumenten in den 1990er-Jahren zugunsten des kollektiven Verkehrs hätte umpolen wollen, habe das aber nur in geringerem Maße erreicht. Billige Preise jedoch kurbeln die Nachfrage an, bei welchem Angebot auch immer. In diesem Fall heißt das: Mehr Züge, mehr Gleise, so würde der Verlust immer größer. Trotz den günstigen Preisen beschwerten sich immer mehr Bahnreisende zu Recht über Mängel bei Komfort, Sitzplätzen, Service, Sauberkeit und personeller Präsenz. Mit der Politik billiger Abonnemente sei bei Benützern und Politikern das Bewusstsein für die tatsächlichen hohen Kosten des Bahnfahrens abhanden gekommen. Man verwechsle offenbar den Preis mit den Kosten.
Es folgen weitere Argumente (gegen den öffentlichen Verkehr) und für den Individualverkehr, der seine Kosten voll decke. Ich erspare mir diese (nicht stimmigen) Aussagen, weil die externen Kosten einfach weggelassen werden.
Trotzdem, mitunter beschleicht mich das Gefühl, als dass der Kostendeckungsgrad mit 41% recht hoch wäre. Wie sieht das hierzulande aus, bei der Bahn, beim Bus?
Viele Grüße vom Vielfahrer
der gestrige Beitrag in der NZZ hat kontroverse Reaktionen dort ausgelöst. Auf einer ganzen Seite dazu kann man heute Denkanstöße zur Verkehrspolitik lesen. Einer kommt dabei zum Fazit, das Fahren mit der Eisenbahn sei zu günstig. So würde der Eigenwirtschaftlichkeitsgrad der Eisenbahnen in der Schweiz gerade noch 41% betragen, während er vor 20 Jahren noch bei 64,5% gelegen habe. Einem Nettoertrag von 7 Mrd. SFr. sünden Transferzahlungen der öffentlichen Hand von 10,2 Mrd. SFr. gegenüber. Damit würden Bahnkunden faktisch 60% Rabatt gewährt. Gründe dafür werden darin gesehen, dass man ie Konsumenten in den 1990er-Jahren zugunsten des kollektiven Verkehrs hätte umpolen wollen, habe das aber nur in geringerem Maße erreicht. Billige Preise jedoch kurbeln die Nachfrage an, bei welchem Angebot auch immer. In diesem Fall heißt das: Mehr Züge, mehr Gleise, so würde der Verlust immer größer. Trotz den günstigen Preisen beschwerten sich immer mehr Bahnreisende zu Recht über Mängel bei Komfort, Sitzplätzen, Service, Sauberkeit und personeller Präsenz. Mit der Politik billiger Abonnemente sei bei Benützern und Politikern das Bewusstsein für die tatsächlichen hohen Kosten des Bahnfahrens abhanden gekommen. Man verwechsle offenbar den Preis mit den Kosten.
Es folgen weitere Argumente (gegen den öffentlichen Verkehr) und für den Individualverkehr, der seine Kosten voll decke. Ich erspare mir diese (nicht stimmigen) Aussagen, weil die externen Kosten einfach weggelassen werden.
Trotzdem, mitunter beschleicht mich das Gefühl, als dass der Kostendeckungsgrad mit 41% recht hoch wäre. Wie sieht das hierzulande aus, bei der Bahn, beim Bus?
Viele Grüße vom Vielfahrer
- Hannes
- Weichensteller
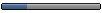
- Beiträge: 1083
- Registriert: Di 11. Mär 2008, 22:50
- Alter: 35
Re: 45.000 Fahrgäste pro Spitzenstunde in Zürich erwartet
Ja, da führt man schnell lange und nur die Fronten verhärtende Diskussionen. In Ballungsräumen und z.B. auf Autobahnen wäre sicherlich etwas mit Mautsystemen machbar, aber das ist natürlich gerade im Autoland Deutschland unpopulär. Genauso, wenn man das Wort "Steuern" wörtlich nimmt, um sie wirklich so anzupassen, dass sie auch steuern.Vielfahrer hat geschrieben:Es folgen weitere Argumente (gegen den öffentlichen Verkehr) und für den Individualverkehr, der seine Kosten voll decke. Ich erspare mir diese (nicht stimmigen) Aussagen, weil die externen Kosten einfach weggelassen werden.
Zahlen explizit zu Verkehrsmitteln sind mir leider auch keine bekannt, bei Verbünden ist da von 30 bis (nahezu) 100 % alles vorhanden, wobei die älteren Verbünde, gerade auch im Süden, die höchstens Kostendeckungsgrade aufweisen (Stuttgart 94,6 % oder so, München gar bei 100 % oder es bezog sich dort nur auf die MVG). Je höher der Kostendeckungsgrad, umso besser können die Unternehmen natürlich auch unabhängig(er) von der Politik/einem Besteller kurzfristige Angebotsverbesserungen oder -anpassungen durchführen. Eine gewisse Kontinuität bei Linienführungen und Fahrplanangebot halte ich im Öffentlichen Verkehr zwar für wichtig, trotzdem sollte man natürlich auch mal etwas kurzfristiger reagieren können, natürlich zum Wohl der Fahrgäste und des Unternehmens. Bei Zukunft Mobilität gab es in der Hinsicht auch mal einen Artikel, den ich gerade leider nicht wiederfinde. Einer der interessantesten Punkte in meinen Augen war dort der Vorschlag, dass sich die Verkehrsunternehmen anonymisierte Handybewegungsdaten besorgen sollten, um Verkehrsströme analysieren und darauf kurzfristiger das Angebot anpassen können.Vielfahrer hat geschrieben:Trotzdem, mitunter beschleicht mich das Gefühl, als dass der Kostendeckungsgrad mit 41% recht hoch wäre. Wie sieht das hierzulande aus, bei der Bahn, beim Bus?
Grüße, Hannes
"Deutsche siegen im Fußball, aber bei der Bahn ist täglich Cordoba."
ÖBB-Chef Christian Kern in der Kronenzeitung vom 8.11.14
ÖBB-Chef Christian Kern in der Kronenzeitung vom 8.11.14
-
Vielfahrer
- Örtlicher Betriebsleiter
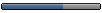
- Beiträge: 4880
- Registriert: So 1. Aug 2010, 13:32
- Wohnort: Tübingen Weststadt
Re: 45.000 Fahrgäste pro Spitzenstunde in Zürich erwartet
Hallo Hannes,
ich sehe das etwas kritischer. Nehmen wir mal an, eine Linie ist kostendeckend, bekommt also keine Zuschüsse (d.h. sie ist eigenwirtschaftlich). Dann müssten die Einnahmen aus dem Verkehr die Kosten der Produktion decken (einschließlich Vertrieb usw.).
Aber in den Einnahmen sind ja schon in beachtlichem Umgang staatliche Subventionen enthalten. Ich meine damit, dass manche Buslinien weit über 75% Schüler aufweisen. Diese bezahlen ihre Fahrkarten ja nicht selbst, sie bezahlen nur einen Eigenanteil, den Rest tragen bei uns die Landkreise. Dann gibt es darauf Ausgleichszahlungen nach § 45a PBefG und ggf. auch noch pauschale Ausgleichszahlungen für die Beförderung von mobilitätseingeschränkten Menschen. Weiter sind die Fahrzeuge mit Hilfe von Fahrzeugförderungen vergünstigt erworben worden, die Betriebshöfe mit GVFG-Mitteln gebaut usw. Also irgendwo in das System sind staatliche Mittel geflossen. Nur das Geld, das unmittelbar im Bus eingenommen wird bzw. von den Konten der Fahrgäste abgebucht wird, sehe ich bei dieser Betrachtung als Einnahme an, alles andere mal nicht. Dabei dürfte eigentlich kein Verkehr mehr seine Kosten decken. Auch sind die Verbundtarife, die die Fahrgäste bezahlen, geringer als die Haustarife der Verkehrsunternehmen, also da stecken ja auch schon staatliche Leistungen drin. Ich will nun nicht das System schlecht machen, aber zu denken muss es einem schon geben, wenn wir mal davon ausgehen, dass in der Schweiz 41% Kostendeckung erreicht werden. Das dürfte eigentlich sehr hoch sein.
Viele Grüße vom Vielfahrer
ich sehe das etwas kritischer. Nehmen wir mal an, eine Linie ist kostendeckend, bekommt also keine Zuschüsse (d.h. sie ist eigenwirtschaftlich). Dann müssten die Einnahmen aus dem Verkehr die Kosten der Produktion decken (einschließlich Vertrieb usw.).
Aber in den Einnahmen sind ja schon in beachtlichem Umgang staatliche Subventionen enthalten. Ich meine damit, dass manche Buslinien weit über 75% Schüler aufweisen. Diese bezahlen ihre Fahrkarten ja nicht selbst, sie bezahlen nur einen Eigenanteil, den Rest tragen bei uns die Landkreise. Dann gibt es darauf Ausgleichszahlungen nach § 45a PBefG und ggf. auch noch pauschale Ausgleichszahlungen für die Beförderung von mobilitätseingeschränkten Menschen. Weiter sind die Fahrzeuge mit Hilfe von Fahrzeugförderungen vergünstigt erworben worden, die Betriebshöfe mit GVFG-Mitteln gebaut usw. Also irgendwo in das System sind staatliche Mittel geflossen. Nur das Geld, das unmittelbar im Bus eingenommen wird bzw. von den Konten der Fahrgäste abgebucht wird, sehe ich bei dieser Betrachtung als Einnahme an, alles andere mal nicht. Dabei dürfte eigentlich kein Verkehr mehr seine Kosten decken. Auch sind die Verbundtarife, die die Fahrgäste bezahlen, geringer als die Haustarife der Verkehrsunternehmen, also da stecken ja auch schon staatliche Leistungen drin. Ich will nun nicht das System schlecht machen, aber zu denken muss es einem schon geben, wenn wir mal davon ausgehen, dass in der Schweiz 41% Kostendeckung erreicht werden. Das dürfte eigentlich sehr hoch sein.
Viele Grüße vom Vielfahrer
- Hannes
- Weichensteller
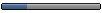
- Beiträge: 1083
- Registriert: Di 11. Mär 2008, 22:50
- Alter: 35
Re: 45.000 Fahrgäste pro Spitzenstunde in Zürich erwartet
Hallo Vielfahrer,
mir ist schon klar, dass da einiges mit drinsteckt und es hängt ja auch immer vom einzelnen Unternehmen/Unternehmer ab. Trotzdem sollte es ja auch Ziel dieser Förderung sein, Fahrgäste zu gewinnen und vorhandene Kapazitäten bestmöglichst auszunutzen.
Einen schönen Ansatz finde ich die neuen landesweiten Jugendtickets für Schüler und Azubis in Österreich: Pressemitteilung Wenn dadurch die Einnahmen konstant bleiben oder leicht steigen und vorhandene Kapazitäten besser ausgelastet werden, finde ich das beispielhaft.
Grüße, Hannes
mir ist schon klar, dass da einiges mit drinsteckt und es hängt ja auch immer vom einzelnen Unternehmen/Unternehmer ab. Trotzdem sollte es ja auch Ziel dieser Förderung sein, Fahrgäste zu gewinnen und vorhandene Kapazitäten bestmöglichst auszunutzen.
Einen schönen Ansatz finde ich die neuen landesweiten Jugendtickets für Schüler und Azubis in Österreich: Pressemitteilung Wenn dadurch die Einnahmen konstant bleiben oder leicht steigen und vorhandene Kapazitäten besser ausgelastet werden, finde ich das beispielhaft.
Grüße, Hannes
"Deutsche siegen im Fußball, aber bei der Bahn ist täglich Cordoba."
ÖBB-Chef Christian Kern in der Kronenzeitung vom 8.11.14
ÖBB-Chef Christian Kern in der Kronenzeitung vom 8.11.14