Hallo,
heute habe ich bei der Fahrt durch den Lötschberg-Basistunnel exakt die Fahrzeit durch den Tunnel gestoppt. Allerdings ging es vergleichsweise langsam in den Tunnel, warum, das weiß ich nicht. Die Ausfahrt jedoch erfolgte in flottem Tempo. Die Dauer heute war 11 Minuten und 26,6 Sekunden. Sämtliche Züge zwischen Tübingen Hbf und Sion waren pünktlich, mitunter sogar 2 Minuten vor der im Fahrplan angegebenen Ankunftszeit am Ziel.
Die Züge waren gut besetzt.
Viele Grüße vom Vielfahrer
In weniger als 10 Minuten durch die Alpen
-
Vielfahrer
- Örtlicher Betriebsleiter
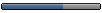
- Beiträge: 4880
- Registriert: So 1. Aug 2010, 13:32
- Wohnort: Tübingen Weststadt
-
wolfgang65
- Rangierhelfer
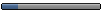
- Beiträge: 792
- Registriert: Di 8. Jan 2008, 20:58
- Wohnort: Villingen
Re: In weniger als 10 Minuten durch die Alpen
Hallo Hannes,
eine sehr interessante Berechnung!
Die Annahme dass die Länge des Tunnels deutlich größer sein sollte als die Länge des Zuges war mir auf den ersten Blick eingängig. Was mich zum Nachdenken gebracht hat ist, dass die Gesamtlänge des Tunnels nicht in die Berechnung mit eingehen soll.
Halbwegs verstehen konnte ich es dann, als ich mir das Verhältnis 4.5 zwischen Fahrzeugs- und Gesamttunnelquerschnittsfläche auffiel. Dieses Verhältnis hätte ich aus dem Steh-greif kleiner geschätzt.
Interessant wäre hierzu noch die resultierende Geschwindigkeit der - vermutlich halbwegs laminaren - Luftströmung zu kennen, die der fahrende Zug im Tunnel verursacht - diese geht ja durch Reibungsverluste (wohl quadratisch mit V ansteigend) an den Tunnelwänden direkt in den zusätzlichen Energieverbrauch der Lok mit ein. Könnte man diese evtl sogar über das oben stehende Verhältnis 4.5 annähern?? Oder ist das kompletter Unfug?
Sollte diese Annäherung tatsächlich der Realität entsprechen, müsste eine grob 40-50km/h schnelle Luftströmung im Tunnel entstehen (der Neat ist, wenn ich das richtig sehe, als geschlossene Röhre ausgeführt und hat ja keine Quertraversen).
Die Geschwindigkeit dieser Strömung dürfte auch ein Maß für den Einfluß der Länge des Tunnels auf das Ergebnis zu sein - soll heißen - um so niedriger diese Geschwindigkeit umso weniger geht die Länge des Tunnel in das Gesamtergebnis ein. Da diese in deiner Formel nicht vorkommt, müssten diese relativ niedrig sein - also wohl anders als meine Annahme.
Gibt es dazu irgendwelche belastbaren Daten? Würde mich interessieren.
Grüße
Wolfgang
eine sehr interessante Berechnung!
Die Annahme dass die Länge des Tunnels deutlich größer sein sollte als die Länge des Zuges war mir auf den ersten Blick eingängig. Was mich zum Nachdenken gebracht hat ist, dass die Gesamtlänge des Tunnels nicht in die Berechnung mit eingehen soll.
Halbwegs verstehen konnte ich es dann, als ich mir das Verhältnis 4.5 zwischen Fahrzeugs- und Gesamttunnelquerschnittsfläche auffiel. Dieses Verhältnis hätte ich aus dem Steh-greif kleiner geschätzt.
Interessant wäre hierzu noch die resultierende Geschwindigkeit der - vermutlich halbwegs laminaren - Luftströmung zu kennen, die der fahrende Zug im Tunnel verursacht - diese geht ja durch Reibungsverluste (wohl quadratisch mit V ansteigend) an den Tunnelwänden direkt in den zusätzlichen Energieverbrauch der Lok mit ein. Könnte man diese evtl sogar über das oben stehende Verhältnis 4.5 annähern?? Oder ist das kompletter Unfug?
Sollte diese Annäherung tatsächlich der Realität entsprechen, müsste eine grob 40-50km/h schnelle Luftströmung im Tunnel entstehen (der Neat ist, wenn ich das richtig sehe, als geschlossene Röhre ausgeführt und hat ja keine Quertraversen).
Die Geschwindigkeit dieser Strömung dürfte auch ein Maß für den Einfluß der Länge des Tunnels auf das Ergebnis zu sein - soll heißen - um so niedriger diese Geschwindigkeit umso weniger geht die Länge des Tunnel in das Gesamtergebnis ein. Da diese in deiner Formel nicht vorkommt, müssten diese relativ niedrig sein - also wohl anders als meine Annahme.
Gibt es dazu irgendwelche belastbaren Daten? Würde mich interessieren.
Grüße
Wolfgang
- Hannes
- Weichensteller
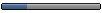
- Beiträge: 1083
- Registriert: Di 11. Mär 2008, 22:50
- Alter: 35
Re: In weniger als 10 Minuten durch die Alpen
Hallo Wolfgang,
ich glaube, das wird schon zu speziell, um da noch Aussagen treffen zu können. Da müssten wohl eher Physiker und Bauingenieure ran, auf die Schnelle hab ich auch keine weitere Literatur darüber finden können.
Ich kann mir vorstellen, dass ab einem gewissen Abstand zum Zug (würde jetzt im LBT einfach mal halbe Tunnellänge annehmen oder halber Weg bis zur Überleitstelle, , wo eine entgegengesetzte Strömung vorhanden sein kann) die Strömung nur noch eher gering ist, da die Luft ja wieder in einen ausgeglicheneren Zustand gelangen kann. Den Effekt kann man ja in S-Bahn-Tunnel beobachten, wobei das natürlich ein schwieriger Vergleich ist, da hier Ausbreitungsvolumen auf den Bahnsteigen zur Verfügung steht und die S-Bahnen auch in geringerem Abstand anhalten und die Luftmassen damit auch wieder etwas bremsen, was im LBT ja nicht passiert.
Noch ein paar weitere Infos zum LBT beim EIU: http://www.bls.ch/d/infrastruktur/neat- ... ysteme.php
Grüße, Hannes
ich glaube, das wird schon zu speziell, um da noch Aussagen treffen zu können. Da müssten wohl eher Physiker und Bauingenieure ran, auf die Schnelle hab ich auch keine weitere Literatur darüber finden können.
Ich vermute, die Formel, die in unserer Formelsammlung vorhanden ist, ist eher auf deutsche Eisenbahntunnel zugeschnitten, deren Länge ja 10 km nicht überschreitet und bei den meisten Strecken sowieso noch deutlich kürzer ist, daher wohl eher vernachlässigbar. Im Artikel ist ja eine leicht andere Formel genannt, wo es auch heißtwolfgang65 hat geschrieben:Was mich zum Nachdenken gebracht hat ist, dass die Gesamtlänge des Tunnels nicht in die Berechnung mit eingehen soll.
Einen Einfluss spielen da sicher auch die Ausbreitungsmöglichkeiten der Luft, wie auch im oben verlinkten Artikel dargestellt. So ist der LBT ja extra abgeschlossen bis auf die Überleitstelle, so dass die Luft sich nicht verwirbeln kann während im Eurotunnel die Querstollen zum Servicetunnel hin offen sind und deshalb eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h gilt, wie ich auch erst jetzt erfahren habe:mit v Fahrgeschwindigkeit, m Zugmasse, k0 bis k5 von der
Zuggestaltung abhängige Faktoren und ist abhängig von
der Tunnel- und Zuglänge, dem Verhältnis von Tunnel-
und Fahrzeugquerschnitt und von der Rauhigkeit der
Tunnelwand. In der Literatur wird der Tunnelfaktor für
Doppelspurtunnel mit 1,1 bis 1,3 und für Einspurtunnel
mit 1,5 bis 2,0 angegeben.
Der Eurotunnel zwischen Folkestone (Großbritannien)
und Calais (Frankreich) besteht aus zwei Einspurtunneln,
jedoch mit dem Unterschied, dass sich zusätzlich zwischen
den beiden Hauptröhren, die 30 m Abstand haben, eine
Serviceröhre befi ndet, die mit kleinen Fahrzeugen befah-
ren werden kann, wie in Bild 1 ersichtlich [1]. Sie dient
der Instandhaltung, der Evakuierung und zum Druckaus-
gleich. Die aerodynamische Druckwelle kann sich über
die Querschläge, die die Hauptröhren alle 375 m mit der
Serviceröhre verbinden, im gesamten Tunnel ausbreiten.
Im 50,45 km langen Eurotunnel fahren die Züge mit
höchstens 160 km/h, es handelt sich also nicht um eine
Hochgeschwindigkeitsstrecke.
Also im Artikel lag der Fokus ja am Stromabnehmer, dort war eine Prandtlsonde angebracht, die die Strömung gemessen hat. Auf Seite 596, Bild 9 ist ja zu erkennen, dass bei Tempo 230 die axiale Strömung bei bis zu 330 km/h gelegen hat, bedingt durch die Geschwindigkeit des Zuges und den Verdrängungseffekt durch die Querschnittsänderung am Zug. Vergleichbar dürfte der Effekt mit dem gewünschten Effekt an Flugzeugflügeln zur Erzeugung von Auftrieb sein.wolfgang65 hat geschrieben:Interessant wäre hierzu noch die resultierende Geschwindigkeit der - vermutlich halbwegs laminaren - Luftströmung zu kennen, die der fahrende Zug im Tunnel verursacht - diese geht ja durch Reibungsverluste (wohl quadratisch mit V ansteigend) an den Tunnelwänden direkt in den zusätzlichen Energieverbrauch der Lok mit ein. Könnte man diese evtl sogar über das oben stehende Verhältnis 4.5 annähern?? Oder ist das kompletter Unfug?
Sollte diese Annäherung tatsächlich der Realität entsprechen, müsste eine grob 40-50km/h schnelle Luftströmung im Tunnel entstehen (der Neat ist, wenn ich das richtig sehe, als geschlossene Röhre ausgeführt und hat ja keine Quertraversen).
Ich kann mir vorstellen, dass ab einem gewissen Abstand zum Zug (würde jetzt im LBT einfach mal halbe Tunnellänge annehmen oder halber Weg bis zur Überleitstelle, , wo eine entgegengesetzte Strömung vorhanden sein kann) die Strömung nur noch eher gering ist, da die Luft ja wieder in einen ausgeglicheneren Zustand gelangen kann. Den Effekt kann man ja in S-Bahn-Tunnel beobachten, wobei das natürlich ein schwieriger Vergleich ist, da hier Ausbreitungsvolumen auf den Bahnsteigen zur Verfügung steht und die S-Bahnen auch in geringerem Abstand anhalten und die Luftmassen damit auch wieder etwas bremsen, was im LBT ja nicht passiert.
Noch ein paar weitere Infos zum LBT beim EIU: http://www.bls.ch/d/infrastruktur/neat- ... ysteme.php
Grüße, Hannes
"Deutsche siegen im Fußball, aber bei der Bahn ist täglich Cordoba."
ÖBB-Chef Christian Kern in der Kronenzeitung vom 8.11.14
ÖBB-Chef Christian Kern in der Kronenzeitung vom 8.11.14
- Hannes
- Weichensteller
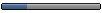
- Beiträge: 1083
- Registriert: Di 11. Mär 2008, 22:50
- Alter: 35
Re: In weniger als 10 Minuten durch die Alpen
Hallo,
ich erlaube mir mal, das Thema zu entstauben, da ich vorhin in der Vorlesung noch ein paar Erkenntnisse dazu gewonnen habe:
Ein Vertreter des Dresdner Instituts für Regional- und Fernverkehrsplanung (iRFP) stellt uns gerade das Programm FBS (Fahrplanbearbeitungssystem), welches bei vielen europäischen Bahnen zur ganzheitlichen Fahrplanung angewandt wird, vor, da wir damit auch einen Beleg erstellen sollen. Für ein letztes Jahr veranstaltetes Anwendertreffen wurde einmal der Energieverbrauch für die fiktive Fahrt eines ICE 3 von Arth-Goldau nach Bellinzona auf dem gleichen Streckenprofil ohne Tunnel, mit zweigleisiger Röhre und mit der realisierten eingleisigen Röhre berechnet. Vergleichsweise wurde der Wert für die Fahrt eines ICE 3 von Erfurt nach Bamberg berechnet, hier sind bis auf einen Tunnel nur zweigleisige Röhren vorhanden. Der ICE 3 wurde herangezogen, da es sich hierbei mit um den Fernverkehrszug mit dem besten Leistungs-Masse-Verhältnis handelt.
Der Gotthard-Basistunnel weist einen Scheitelpunkt nach etwa 2/3 der Strecke auf (vgl. hier), bis dahin bzw. ab dort gibt es 7 Promille Steigung/Gefälle. Der Energieverbrauch ohne Tunnel läge dafür bei etwa 950-1.000 kWh. Bei einer zweigleisigen Röhre lag das ganze irgendwo zwischen 1.500 und 1.700 kWh, für die eingleisige Röhre gar bei 2.900 kWh!
Auch bei der Geschwindigkeit macht sich der Tunnelwiderstand im Hochgeschwindigkeitsverkehr deutlich bemerkbar: Während der Zug von Arth-Goldau her bis zum Tunnelportal bei Erstfeld ohne Probleme auf 250 km/h beschleunigt, bricht die Geschwindigkeit bei voller Fahrleistung auf etwa 180 km/h zusammen, erst ab dem Scheitelpunkt, wenn der Zug sich somit im Gefälle befindet, werden nochmals 200 km/h erreicht. 73 % der Energie zwischen Arth-Goldau und Bellinzona werden insgesamt für den Tunnelwiderstand aufgebraucht.
Bei Erfurt-Bamberg sah es etwas besser aus, da wir hier ja nicht vollständig im Tunnel unterwegs sind, die genauen Werte habe ich bei der Hitze hier aber nicht im Kopf behalten können. Sie lagen aber bei etwa Faktor 1,5-1,7 für die zweigleisige Röhre und 2,4 für eingleisige Röhren. Hier werden nur 23 % der Energie für den Tunnelwiderstand verbraucht, dafür spielt hier die stärkere Steigung rein.
Interessant war dann noch sein Bericht über ein Tunnelprojekt in der Region Oslo, wo anscheinend zum ersten Mal auch vor Baubeginn Berechnungen für den Energieverbrauch und die möglichen Geschwindigkeiten im Tunnel durchgeführt wurden. Dabei kam heraus, dass hierbei kein wesentlicher Gewinn erzielt werden kann, was dann auch (aber nicht nur) zum Abbruch des Vorhabens führte.
Grüße aus dem schwülen Dresden,
Hannes
ich erlaube mir mal, das Thema zu entstauben, da ich vorhin in der Vorlesung noch ein paar Erkenntnisse dazu gewonnen habe:
Ein Vertreter des Dresdner Instituts für Regional- und Fernverkehrsplanung (iRFP) stellt uns gerade das Programm FBS (Fahrplanbearbeitungssystem), welches bei vielen europäischen Bahnen zur ganzheitlichen Fahrplanung angewandt wird, vor, da wir damit auch einen Beleg erstellen sollen. Für ein letztes Jahr veranstaltetes Anwendertreffen wurde einmal der Energieverbrauch für die fiktive Fahrt eines ICE 3 von Arth-Goldau nach Bellinzona auf dem gleichen Streckenprofil ohne Tunnel, mit zweigleisiger Röhre und mit der realisierten eingleisigen Röhre berechnet. Vergleichsweise wurde der Wert für die Fahrt eines ICE 3 von Erfurt nach Bamberg berechnet, hier sind bis auf einen Tunnel nur zweigleisige Röhren vorhanden. Der ICE 3 wurde herangezogen, da es sich hierbei mit um den Fernverkehrszug mit dem besten Leistungs-Masse-Verhältnis handelt.
Der Gotthard-Basistunnel weist einen Scheitelpunkt nach etwa 2/3 der Strecke auf (vgl. hier), bis dahin bzw. ab dort gibt es 7 Promille Steigung/Gefälle. Der Energieverbrauch ohne Tunnel läge dafür bei etwa 950-1.000 kWh. Bei einer zweigleisigen Röhre lag das ganze irgendwo zwischen 1.500 und 1.700 kWh, für die eingleisige Röhre gar bei 2.900 kWh!
Auch bei der Geschwindigkeit macht sich der Tunnelwiderstand im Hochgeschwindigkeitsverkehr deutlich bemerkbar: Während der Zug von Arth-Goldau her bis zum Tunnelportal bei Erstfeld ohne Probleme auf 250 km/h beschleunigt, bricht die Geschwindigkeit bei voller Fahrleistung auf etwa 180 km/h zusammen, erst ab dem Scheitelpunkt, wenn der Zug sich somit im Gefälle befindet, werden nochmals 200 km/h erreicht. 73 % der Energie zwischen Arth-Goldau und Bellinzona werden insgesamt für den Tunnelwiderstand aufgebraucht.
Bei Erfurt-Bamberg sah es etwas besser aus, da wir hier ja nicht vollständig im Tunnel unterwegs sind, die genauen Werte habe ich bei der Hitze hier aber nicht im Kopf behalten können. Sie lagen aber bei etwa Faktor 1,5-1,7 für die zweigleisige Röhre und 2,4 für eingleisige Röhren. Hier werden nur 23 % der Energie für den Tunnelwiderstand verbraucht, dafür spielt hier die stärkere Steigung rein.
Interessant war dann noch sein Bericht über ein Tunnelprojekt in der Region Oslo, wo anscheinend zum ersten Mal auch vor Baubeginn Berechnungen für den Energieverbrauch und die möglichen Geschwindigkeiten im Tunnel durchgeführt wurden. Dabei kam heraus, dass hierbei kein wesentlicher Gewinn erzielt werden kann, was dann auch (aber nicht nur) zum Abbruch des Vorhabens führte.
Grüße aus dem schwülen Dresden,
Hannes
"Deutsche siegen im Fußball, aber bei der Bahn ist täglich Cordoba."
ÖBB-Chef Christian Kern in der Kronenzeitung vom 8.11.14
ÖBB-Chef Christian Kern in der Kronenzeitung vom 8.11.14