Hallo Tannenrainer,
Ab 2019 dürfte es ja mit der Doppelspur eine Lösung geben. Aber auch eine S-Bahn-Verlängerung wäre, mal ganz abgesehen von den deutlich höheren Kosten, sicherlich nicht früher hinzubekommen.
Heute fahren die Ammertalbahnen vielfach nach Reutlingen - Bad Urach oder Wendlingen durch. Ich wundere mich aber mitunter, wieviele Fahrgäste da sitzen bleiben. Besonders viele sind das natürlich am frühen Morgen auch nach Tübingen-Derendingen. Zahlen allerdings habe ich keine parat, aber das dürfte nahezu an das Gesamtaufkommen in Herrenberg heranreichen.
Dein Vorschlag einer überschlagenen Wende in Herrenberg ist durchaus konstruktiv, dürfte aber daran scheitern, dass man dann in Herrenberg den Bahnhof umbauen müsste. Auch das würde leider lange dauern. Außerdem sind RS1 ja Mangelfahrzeuge im Raum Tübingen. Für die Ammertalbahn waren seinerzeit ja nur 6 Fahrzeuge vorgesehen, so dass man heute noch 4 Shuttle der HzL in der Schülerverkehrsspitze einbinden musste. Bei der Ammertalbahn hatte leider keiner an den durchschlagenden Erfolg geglaubt. Sind früher ein paar Hundert mit den Schienenbussen gefahren, dazu vielleicht noch mal 2.000 mit den parallelen Bahnbussen des RAB, so werden heute rund 8.000 Nutzer gezählt - und es wären sicherlich deutlich mehr, wenn die Pünktlichkeits- und Kapazitätsprobleme gelöst wären.
Viele Grüße vom Vielfahrer
Übergangszeit in Stuttgart Hbf - Wie lange wird gewartet?
-
Vielfahrer
- Örtlicher Betriebsleiter
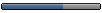
- Beiträge: 4899
- Registriert: So 1. Aug 2010, 13:32
- Wohnort: Tübingen Weststadt
-
GP4Flo
- Weichenputzer
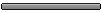
- Beiträge: 97
- Registriert: Sa 6. Feb 2010, 16:56
Re: Übergangszeit in Stuttgart Hbf - Wie lange wird gewartet
Hier noch eine ergänzende Antwort von Heiko Focken (NVBW) zu dem Thema Wartezeitregelung:
Heiko Focken (NVBW) hat geschrieben:[..]Ich erlaube mir, meine Antwort direkt in Ihre Mail hineinzuschreiben, das ist in dieser Situation einfacher.
„Aus Fahrgastsicht wäre es zu begrüßen, wenn in Zukunft vermehrt davon Gebrauch gemacht werden kann“
Grundsätzlich darf ich Ihnen versichern: wo gewartet werden kann, da wird gewartet! So ist es mit den Eisenbahnen in Baden-Württemberg und der DB Netz vereinbart. Damit diese Regelung auch wirklich, wie es so schön heißt, „kundenwirksam“ wird, muss sie natürlich auch im täglichen Alltag gelebt, sprich: vor Ort umgesetzt werden. Meist klappt das auch – oftmals auch, ohne dass der Fahrgast das bewusst mitbekommt. Die Anschlusssicherheit in Baden-Württemberg liegt deutschlandweit auf einem Spitzenplatz.
„Mir ist bewusst, dass auf eingleisigen Strecken, wie z.B. der Höllentalbahn nicht 10 Minuten gewartet werden kann, aber wenige Minuten sind, entsprechenden Willen vorausgesetzt (zügige Fahrweise), immer drin“
Natürlich haben Fahrpläne meist Pufferzeiten, etwa für Bauarbeiten oder besondere Betriebszustände. Unter dieser Prämisse werden auch die Wartezeiten definiert. Diese beträgt im baden-württembergischen Nahverkehr übrigens 5 Minuten und nicht, wie anderswo im Land, „Null Minuten“. Mitunter muss bzw. kann jedoch davon abgewichen werden – sowohl nach unten als auch nach oben.
„Gerade bei zweigleisigen Strecken besteht ja durchaus etwas Fahrzeitpuffer“
So per se ist das leider nicht richtig. Beispielhaft seien der zwischen zwei Fernverkehrszügen eingeklemmte IRE Stuttgart – Ulm, die Breisgau-S-Bahn zwischen Freiburg, Denzlingen und Elzach oder der minutengenau in verschiedene andere Systeme eingepasste IRE Singen – Basel zu nennen. Bei diesen können schon drei, vier Minuten Verspätung zu Folgeverspätungen und Kollateralschäden führen, die das Kippen ganzer Anschlusssysteme oder einen weiteren Verspätungsaufbau nach sich ziehen. Das interessiert den Fahrgast, dem sein Zug gerade abgefahren ist, in seiner Situation natürlich herzlich wenig. Ignorieren kann man es deshalb aber nicht.
„Da wären wenige Minuten Wartezeit wohl auch tagsüber möglich. So eng kann der Fahrplan schließlich nicht sein, wenn man es sich leisten kann auf einer 160 km/h Strecke teilweise mit 120 km/h Material (BR 143) zu fahren“
Wenn Sie damit den RE am Oberrhein meinen: der hat tatsächlich einen gewissen Puffer. Allerdings darf auch dieser nicht überstrapaziert werden, da kurz vor Freiburg bereits der nächste ICE formatfüllend im Rückspiegel auftaucht. Nota bene machen 160 km/h im Nahverkehr auch nur dort Sinn, wo dieses Tempo als Beharrungsfahrt auch über einen längeren Zeitraum gehalten werden kann. Einen Zug auf 160 km/h hochziehen und dann sofort mit dem Bremsen beginnen macht unter dem Strick vielleicht 10 Sekunden aus und kostet zudem Unmengen an Energie.
„Leider gibt es immer wieder Berichte von Reisenden, denen ein Anschlusszug kurz vor erreichen der Tür vor der Nase weggefahren ist. Gerade solche Fälle sollten doch wenn möglich vermieden werden, da hier vor allem die psychologische Wirkung dem Ansehen des Systems Bahn großen Schaden zufügt. Im Internet lassen sich genügend Berichte dazu finden, wie z.B. folgender“
So etwas ist ein absolutes „no-go“ mit aktiver Kundenvertreibung. Hierbei offenbaren sich zwei Probleme:
- Die „Entvölkerung“ der Eisenbahn. Der jahrzehntelang quasi unter Strafe gestellte und über jeder Wartezeitvorschrift stehende Sichtanschluss (Zug A fährt ein – im selben Moment fährt gegenüber Zug B aus) kann vor Ort nicht mehr kontrolliert werden, wenn etwa der Fahrdienstleiter nicht mehr den Blick auf die Gleise hat oder es keine weisungsbefugte Aufsicht mehr gibt. Niemand sieht, ob Zug A wirklich schon steht, ob wirklich Jemand umsteigt etc.. Konsequenter Weise wurde das „Verbot“ von Sichtanschlüssen vor zwei Jahren abgeschafft – es war schlicht nicht mehr zu kontrollieren. Das mag wie eine Kapitulationserklärung klingen, aber es ist so und wird auch in Zukunft Fahrgäste vor den Kopf stoßen.
- Die Überbestimmung des Systems: Ja, zu Zeiten der gerne gelobten Bundesbahn (oder Reichsbahn) wurde oftmals länger gewartet als heute. Beim Blick in die Fahrpläne zeigt sich auch, warum: wenn, wie beispielsweise im Donautal, nur zwei, drei Mal am Tag ein Zug auf die Reise ging, dann gebot sich das längere Warten quasi von selbst. Gleichzeitig war die Abhängigkeit zu anderen Zügen längst nicht so hoch wie heute, wo ein einziger kranker Zug durch die Vielzahl von Kreuzungen, Anschlüssen oder enge Zugfolgen eine regelrechte Blutspur bis weit in das Land hinein ziehen kann. Oder anders: wenn der Donautalzug der 1980-er Jahre 10 min zu spät durch die Felsen fuhr, dann hat das so gut wie keine betrieblichen Folgen oder Auswirkungen auf andere Züge gehabt. Heute verbiegt er alleine auf dem kurzen Stück Sigmaringen – Donauescingen zunächst in Fridingen die Kreuzung mit dem Gegenzug, sprengt dann die gegenseitige Korrespondenz mit dem Gäubahn-Eilzug in Tuttlingen und bremst hinter Immendingen die folgende Schwarzwaldbahn aus.
- Die „Technisierung“ der Anschlusskommunikation. Dazu gebe ich Ihnen ein konkretes Beispiel:
o Ankunft des ICE aus Berlin in Offenburg zur Minute ´27. Abfahrt der RB nach Lahr – Emmendingen zur Minute ´34. Die Mindestübergangszeit in Offenburg beträgt 4 Minuten.
o Nun hat der ICE 5 min Verspätung. Ankunft in Offenburg also erst ´32.
o Der Anschluss auf die RB fällt aus den bahn-internen Auskunftssystemen, auf die auch der ICE-Schaffner bei seinen Durchsagen zurückgreift, heraus, weil die Mindestübergangszeit von 4 min unterschritten ist. Nächster Zug Richtung Lahr – Emmendingen wäre nach Ansage des Schaffners somit der RE zur min ´07.
o Der Fahrgast bestellt seinen Abholdienst also 30 min später an den Bahnhof nach Lahr und steigt in Offenburg wütend aus dem ICE – und sieht gegenüber die RB stehen. Logisch, denn erstens kann die ja gar nicht abfahren, denn sie nutzt die gleiche Strecke wie der ICE (das muss der Fahrgast aber nicht wissen). Und zweitens hat sie 5 min Wartezeit (womit die Mindestübergangszeit von 4 min wieder erreicht wäre, aber das wiederum weiß das System nicht).
Also alles ziemlich suboptimal, und da stoßen wir auch immer wieder an Grenzen. Zumal ein Blick des Schaffners aus dem ICE-Fenster bei der Einfahrt genügt hätte, um dort die RB stehen zu sehen und noch die Ansage hinterherzuschicken „gegenüber steht noch die RB…“. Aber das wiederum setzt voraus, dass nicht nur die hier überforderte Technik, sondern der gesunde Menschenverstand und etwas Verkehrsgeografie angewendet werden.
Daran, so mein Eindruck, krankt aber zunehmend die nur noch in Regelprozessen denkende Eisenbahn als Gesamtsystem. Jedoch ist dieses Gesamtsystem zu komplex, um es nur nach Standardprozessen zu betreiben. Und genau deshalb „leisten“ wir uns in Baden-Württemberg diese individuelle Wartezeitvorschrift.
Ein gutes Hilfsmittel für eigenständige Planung ist da übrigens nach wie vor das gute alte Kursbuch – das weist auch 2-min Anschlüsse“ aus, egal was der Bahn-Rechner sagt.
„Auch wenn vielleicht 30 Minuten später der nächste Zug fährt, muss man ja immer beachten, dass es möglicherweise weitere Umstiege in der Reisekette gibt. So lange wir in BaWü noch keinen landesweiten 30-Minuten Takt auf allen Strecken haben, kann ein verpasster Anschluss selbst bei folgender Fahrtmöglichkeit 30 Minuten später bei weiteren Umstiegen durchaus eine Verspätung von 120 Minuten bedeuten (z.B. 2-stündlicher IRE nach Ulm oder einzelne Busverbindungen).“
Das kann umgekehrt aber auch dann passieren, wenn der Zug wartet. Dann geht der Anschlusszug 10 min später auf die Reise, und die Umsteiger vom ICE freuen sich. Die Fahrgäste, die an einem Unterwegsbahnhof dadurch ihren Überlandbus verpassen, sehen das aber wohl ein wenig anders.
Irgendjemanden beißen immer die Hunde. Die Kunst besteht darin, abzuwägen, wie tief dieser Biss ist (Wartezeit) und wie viele Leute gebissen werden (zahlenmäßige Betroffenheit). Die 98 nicht gebissenen Fahrgäste freuen sich still. Die zwei anderen schimpfen lauthals über die blöde Bahn. Was also tun?
[...]
Viele Grüße
Heiko Focken
Angebotsplanung und Jahresfahrplan
NVBW - Nahverkehrsgesellschaft
Baden-Württemberg mbH
Wilhelmsplatz 11
70182 Stuttgart
-
Tannenrainer
- Weichenputzer
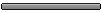
- Beiträge: 171
- Registriert: Di 17. Apr 2012, 23:38
- Wohnort: 72108
Re: Übergangszeit in Stuttgart Hbf - Wie lange wird gewartet
Sehr ausführliche und durchaus interessante Antwort von der NVBW, vielen Dank für`s Einstellen!GP4Flo hat geschrieben:Hier noch eine ergänzende Antwort von Heiko Focken (NVBW) zu dem Thema Wartezeitregelung:
Heiko Focken (NVBW) hat geschrieben:[..]Ich erlaube mir, meine Antwort direkt in Ihre Mail hineinzuschreiben, das ist in dieser Situation einfacher.
„Aus Fahrgastsicht wäre es zu begrüßen, wenn in Zukunft vermehrt davon Gebrauch gemacht werden kann“
Grundsätzlich darf ich Ihnen versichern: wo gewartet werden kann, da wird gewartet! So ist es mit den Eisenbahnen in Baden-Württemberg und der DB Netz vereinbart. Damit diese Regelung auch wirklich, wie es so schön heißt, „kundenwirksam“ wird, muss sie natürlich auch im täglichen Alltag gelebt, sprich: vor Ort umgesetzt werden. Meist klappt das auch – oftmals auch, ohne dass der Fahrgast das bewusst mitbekommt. Die Anschlusssicherheit in Baden-Württemberg liegt deutschlandweit auf einem Spitzenplatz.
„Mir ist bewusst, dass auf eingleisigen Strecken, wie z.B. der Höllentalbahn nicht 10 Minuten gewartet werden kann, aber wenige Minuten sind, entsprechenden Willen vorausgesetzt (zügige Fahrweise), immer drin“
Natürlich haben Fahrpläne meist Pufferzeiten, etwa für Bauarbeiten oder besondere Betriebszustände. Unter dieser Prämisse werden auch die Wartezeiten definiert. Diese beträgt im baden-württembergischen Nahverkehr übrigens 5 Minuten und nicht, wie anderswo im Land, „Null Minuten“. Mitunter muss bzw. kann jedoch davon abgewichen werden – sowohl nach unten als auch nach oben.
„Gerade bei zweigleisigen Strecken besteht ja durchaus etwas Fahrzeitpuffer“
So per se ist das leider nicht richtig. Beispielhaft seien der zwischen zwei Fernverkehrszügen eingeklemmte IRE Stuttgart – Ulm, die Breisgau-S-Bahn zwischen Freiburg, Denzlingen und Elzach oder der minutengenau in verschiedene andere Systeme eingepasste IRE Singen – Basel zu nennen. Bei diesen können schon drei, vier Minuten Verspätung zu Folgeverspätungen und Kollateralschäden führen, die das Kippen ganzer Anschlusssysteme oder einen weiteren Verspätungsaufbau nach sich ziehen. Das interessiert den Fahrgast, dem sein Zug gerade abgefahren ist, in seiner Situation natürlich herzlich wenig. Ignorieren kann man es deshalb aber nicht.
„Da wären wenige Minuten Wartezeit wohl auch tagsüber möglich. So eng kann der Fahrplan schließlich nicht sein, wenn man es sich leisten kann auf einer 160 km/h Strecke teilweise mit 120 km/h Material (BR 143) zu fahren“
Wenn Sie damit den RE am Oberrhein meinen: der hat tatsächlich einen gewissen Puffer. Allerdings darf auch dieser nicht überstrapaziert werden, da kurz vor Freiburg bereits der nächste ICE formatfüllend im Rückspiegel auftaucht. Nota bene machen 160 km/h im Nahverkehr auch nur dort Sinn, wo dieses Tempo als Beharrungsfahrt auch über einen längeren Zeitraum gehalten werden kann. Einen Zug auf 160 km/h hochziehen und dann sofort mit dem Bremsen beginnen macht unter dem Strick vielleicht 10 Sekunden aus und kostet zudem Unmengen an Energie.
„Leider gibt es immer wieder Berichte von Reisenden, denen ein Anschlusszug kurz vor erreichen der Tür vor der Nase weggefahren ist. Gerade solche Fälle sollten doch wenn möglich vermieden werden, da hier vor allem die psychologische Wirkung dem Ansehen des Systems Bahn großen Schaden zufügt. Im Internet lassen sich genügend Berichte dazu finden, wie z.B. folgender“
So etwas ist ein absolutes „no-go“ mit aktiver Kundenvertreibung. Hierbei offenbaren sich zwei Probleme:
- Die „Entvölkerung“ der Eisenbahn. Der jahrzehntelang quasi unter Strafe gestellte und über jeder Wartezeitvorschrift stehende Sichtanschluss (Zug A fährt ein – im selben Moment fährt gegenüber Zug B aus) kann vor Ort nicht mehr kontrolliert werden, wenn etwa der Fahrdienstleiter nicht mehr den Blick auf die Gleise hat oder es keine weisungsbefugte Aufsicht mehr gibt. Niemand sieht, ob Zug A wirklich schon steht, ob wirklich Jemand umsteigt etc.. Konsequenter Weise wurde das „Verbot“ von Sichtanschlüssen vor zwei Jahren abgeschafft – es war schlicht nicht mehr zu kontrollieren. Das mag wie eine Kapitulationserklärung klingen, aber es ist so und wird auch in Zukunft Fahrgäste vor den Kopf stoßen.
- Die Überbestimmung des Systems: Ja, zu Zeiten der gerne gelobten Bundesbahn (oder Reichsbahn) wurde oftmals länger gewartet als heute. Beim Blick in die Fahrpläne zeigt sich auch, warum: wenn, wie beispielsweise im Donautal, nur zwei, drei Mal am Tag ein Zug auf die Reise ging, dann gebot sich das längere Warten quasi von selbst. Gleichzeitig war die Abhängigkeit zu anderen Zügen längst nicht so hoch wie heute, wo ein einziger kranker Zug durch die Vielzahl von Kreuzungen, Anschlüssen oder enge Zugfolgen eine regelrechte Blutspur bis weit in das Land hinein ziehen kann. Oder anders: wenn der Donautalzug der 1980-er Jahre 10 min zu spät durch die Felsen fuhr, dann hat das so gut wie keine betrieblichen Folgen oder Auswirkungen auf andere Züge gehabt. Heute verbiegt er alleine auf dem kurzen Stück Sigmaringen – Donauescingen zunächst in Fridingen die Kreuzung mit dem Gegenzug, sprengt dann die gegenseitige Korrespondenz mit dem Gäubahn-Eilzug in Tuttlingen und bremst hinter Immendingen die folgende Schwarzwaldbahn aus.
- Die „Technisierung“ der Anschlusskommunikation. Dazu gebe ich Ihnen ein konkretes Beispiel:
o Ankunft des ICE aus Berlin in Offenburg zur Minute ´27. Abfahrt der RB nach Lahr – Emmendingen zur Minute ´34. Die Mindestübergangszeit in Offenburg beträgt 4 Minuten.
o Nun hat der ICE 5 min Verspätung. Ankunft in Offenburg also erst ´32.
o Der Anschluss auf die RB fällt aus den bahn-internen Auskunftssystemen, auf die auch der ICE-Schaffner bei seinen Durchsagen zurückgreift, heraus, weil die Mindestübergangszeit von 4 min unterschritten ist. Nächster Zug Richtung Lahr – Emmendingen wäre nach Ansage des Schaffners somit der RE zur min ´07.
o Der Fahrgast bestellt seinen Abholdienst also 30 min später an den Bahnhof nach Lahr und steigt in Offenburg wütend aus dem ICE – und sieht gegenüber die RB stehen. Logisch, denn erstens kann die ja gar nicht abfahren, denn sie nutzt die gleiche Strecke wie der ICE (das muss der Fahrgast aber nicht wissen). Und zweitens hat sie 5 min Wartezeit (womit die Mindestübergangszeit von 4 min wieder erreicht wäre, aber das wiederum weiß das System nicht).
Also alles ziemlich suboptimal, und da stoßen wir auch immer wieder an Grenzen. Zumal ein Blick des Schaffners aus dem ICE-Fenster bei der Einfahrt genügt hätte, um dort die RB stehen zu sehen und noch die Ansage hinterherzuschicken „gegenüber steht noch die RB…“. Aber das wiederum setzt voraus, dass nicht nur die hier überforderte Technik, sondern der gesunde Menschenverstand und etwas Verkehrsgeografie angewendet werden.
Daran, so mein Eindruck, krankt aber zunehmend die nur noch in Regelprozessen denkende Eisenbahn als Gesamtsystem. Jedoch ist dieses Gesamtsystem zu komplex, um es nur nach Standardprozessen zu betreiben. Und genau deshalb „leisten“ wir uns in Baden-Württemberg diese individuelle Wartezeitvorschrift.
Ein gutes Hilfsmittel für eigenständige Planung ist da übrigens nach wie vor das gute alte Kursbuch – das weist auch 2-min Anschlüsse“ aus, egal was der Bahn-Rechner sagt.
„Auch wenn vielleicht 30 Minuten später der nächste Zug fährt, muss man ja immer beachten, dass es möglicherweise weitere Umstiege in der Reisekette gibt. So lange wir in BaWü noch keinen landesweiten 30-Minuten Takt auf allen Strecken haben, kann ein verpasster Anschluss selbst bei folgender Fahrtmöglichkeit 30 Minuten später bei weiteren Umstiegen durchaus eine Verspätung von 120 Minuten bedeuten (z.B. 2-stündlicher IRE nach Ulm oder einzelne Busverbindungen).“
Das kann umgekehrt aber auch dann passieren, wenn der Zug wartet. Dann geht der Anschlusszug 10 min später auf die Reise, und die Umsteiger vom ICE freuen sich. Die Fahrgäste, die an einem Unterwegsbahnhof dadurch ihren Überlandbus verpassen, sehen das aber wohl ein wenig anders.
Irgendjemanden beißen immer die Hunde. Die Kunst besteht darin, abzuwägen, wie tief dieser Biss ist (Wartezeit) und wie viele Leute gebissen werden (zahlenmäßige Betroffenheit). Die 98 nicht gebissenen Fahrgäste freuen sich still. Die zwei anderen schimpfen lauthals über die blöde Bahn. Was also tun?
[...]
Viele Grüße
Heiko Focken
Angebotsplanung und Jahresfahrplan
NVBW - Nahverkehrsgesellschaft
Baden-Württemberg mbH
Wilhelmsplatz 11
70182 Stuttgart
Aber trotzdem mehr als unbefriedigend, was mein konkretes Erlebnis und damit den Auslöser dieses Threads angeht, so daß ich mich ausnahmsweise einmal selbst zitieren möchte:
Ohne jetzt auf unserem mißglückten Übergang in Stuttgart groß rumreiten zu wollen (dazu sind mir doch in den letzten 30 Jahren ÖPNV-Nutzung gar zu viele Anschlüsse davon gefahren...), aber meine Empörung darüber, daß am späten Samstagabend nicht einmal 5 (!) Minuten auf einen verspäteten Fernzug gewartet wird, hat sich seitdem noch nicht gelegt!
Im Übrigen, hätten wir nicht "bloß" Bondorf als Ziel gehabt, sondern z.B. Donaueschingen oder Bräunlingen, so wäre diese Verbindung die letzte an diesem Tag gewesen...
Wir sind dann noch relativ schmerzfrei eine Stunde später als geplant nach Hause gekommen, aber für viele andere Umsteiger war es mit Sicherheit wesentlich schwieriger, überhaupt noch in Richtung Heimatbahnhof zu kommen!
Da fühle ich mich durch die wohlmeinenden Ausführungen der NVBW doch leicht veralbert!
Gruß
Tannenrainer