Hallo,
die Waldenburgerbahn im führt von Liestal ins 13 km entfernte Waldenburg und wurde vor drei Jahren grundlegend modernisiert. Für die Neue Zürcher Zeitung befasst sich Dominik Feldges aus Waldenburg mit interessanten Aspekten dieser Bahn.
Viele Grüße vom Vielfahrer
Der Kontrast zwischen dem historischen Dorfkern der Baselbieter Gemeinde Waldenburg und dem neuen Bahnhof Waldenburg Station könnte kaum größer sein. An diesem Werktag sind im Dorf trotz sonnigem und warmem Wetter kaum Menschen zu sehen. Viele der alten Gebäude entlang der Hauptstraße könnten einen neuen Anstrich gut gebrauchen. Mehrere Restaurants sind seit Jahren verwaist. Läden gibt es fast keine mehr.
Bei der Bahnstation herrscht um diese Zeit auch wenig Betrieb. Doch die Fahrzeuge der Waldenburgerbahn (WB), die dort kehrtmachen zurück in den Kantonshauptort Liestal fahren, sind ebenfalls neu.
Die gelb-roten Kompositionen schauen aus, als ob sie die Fabrik des Herstellers Stadler Rail im spanischen Valencia erst gerade verlassen hätten. In Betrieb gingen die Fahrzeuge Ende 2022. Der Betreiber der WB, das Staatsunternehmen BLT Baselland Transport AG, erwarb zum Preis von 55 Millionen Franken insgesamt 10 neue Kompositionen. Er ersetzte damit die gesamte bisherige Flotte auf dieser altehrwürdigen Strecke, die auf eine 145-jährige Geschichte zurückblickt.
Das war aber längst nicht alles. Von April 2021 bis Ende 2022 erneuerte die BLT die gesamte Infrastruktur zwischen Waldenburg und Liestal. Auf einer Länge von 13 Kilometern wurden neue Schienen verlegt, Haltestellen modernisiert und neue Barrieren installiert. All das kostete weitere 320 Millionen Franken.
Was wegkam, waren die Signale. Die 40 Wagenführer, die für die WB im Einsatz stehen, müssen seither so gut wie keine Blinklichter und andere Signale mehr entlang der Strecke beachten. Statt im Außenbereich spielt sich die Signalisierung im Führerstand auf einem Bildschirm ab. Die Waldenburgerbahn befindet sich in einem Transformationsprozess. Bis in fünf Jahren sollen die Züge sogar führerlos auf der Strecke verkehren.
Die Strecke besser auslasten
Das Kernstück der neuen Lösung ist ein sogenanntes Communication-Based-Brain-Control-System, das Stadler im Werk im zürcherischen Wallisellen von Grund auf neu entwickelte. Es ermöglicht, dass die Fahrzeuge direkt miteinander kommunizieren. „Die Zugführung erfolgt komplett digital“, führt Marc Trippel aus, der b ei Stadler die Sparte Signalling leitet und damit für das Angebot des Thurgauer Konzerns im Bereich Signaltechnik verantwortlich zeichnet.
Dank der digitalen Zugführung können die Kompositionen der WB nun zum Beispiel näher aufeinander auffahren. Dies erlaubt eine bessere Auslastung der Strecke, die meistenorts noch immer eingleisig verläuft.
Die Fahrzeit gegenüber dem früheren Betrieb mit konventioneller Signaltechnik konnte um 3 Minuten reduziert werden. „Das klingt nicht nach viel“, sagt Philipp Glogg, der. bei der BLT als Technologiechef den technischen Betrieb verantwortet. Doch mit Blick auf die bisherige Fahrzeit von 25 Minuten betrage die Zeitersparnis gleichwohl über 10 Prozent. Glogg verweist zudem auf eine erhöhte Fahrplanstabilität.
Für die Wagenführer bedeutet die Einführung der neuen Technik eine entspanntere Arbeit. In Gegenden außerhalb des Siedlungsbereichs mache das Fahrzeug nun alles selbst, schwärmt Marco Röthlisberger im Führerstand auf der Fahrt von Waldenburg nach Liestal. „Hier kann ich mich zurücklehnen und muss nur in Notfällen eingreifen“, sagt der 43-jährige, der sich vor drei Jahren bei der BLT vom Schreiner zum Wagenführer umschulen ließ.
Die Fahrzeuge der Waldenburgerbahn fahren bereits im hohen Grad automatisch. Die Wagenführer steuern laut dem Hersteller Stadler lediglich noch den Start, den Halt und die Türen auf dieser isolierten, vom übrigen Bahnverkehr abgeschnittenen Strecke.
Ein solches System der Fahrerassistenz wird ab diesem Sommer auch die Südostbahn (SOB) in einem einjährigen Praxistest zwischen Biberbrugg und Arth-Goldau erproben. Anders als die Waldenburgerbahn ist die SOB keine Schmalspurbahn. Sie operiert wie die SBB im Normalspurbereich, bei dem technisch und regulatorisch höhere Anforderungen erfüllt werden müssen. Allerdings ist die Linie zwischen Biberbrugg und Arth-Goldau ebenfalls eine Nebenstrecke und für Schweizer Verhältnisse wenig befahren.
Bei der Waldenburgerbahn werden in der nächsten Phase der Automatisierung ab diesem Sommer die Fahrer nur noch eine überwachende Funktion haben und die Türen bedienen. Danach sollen statt Wagenführern lediglich Zugbegleiter mitfahren, die bei Bedarf intervenieren können. Bei der letzten Stufe der Automatisierung, dem autonomen Betrieb, wird es kein Personal mehr an Bord geben.
Selbständig aus dem Depot
Wenn es nach dem Willen der BLT geht, sollen die Fahrzeuge schon in wenigen Jahren autonom verkehren. „Wir wollen 2030 bei der Waldenburgerbahn ohne Personal fahren“, sagt Frederic Monard, der Chef des Transportunternehmens.
Der 45-jährige Manager, der vor zwei Jahren aus der IT-Industrie zur Firma stieß, hält dank der neuen Signaltechnik und den auf sie abgestimmten Fahrzeugen diese Vorgabe auf Überlandstrecken für erreichbar. Zurückhaltender beurteilt Monard die Entwicklung mit Blick auf Tramstrecken in dicht besiedelten Gebieten, wie sie die BLT in Basel und benachbarten Baselbieter Gemeinden ebenfalls befährt. „Ob ich den fahrerlosen Betrieb dort noch erleben werde, darüber bin ich mir nicht sicher.“
Marco Röthlisberger glaubt, dass die Einführung des fahrerlosen Betriebs mehr Zeit als bis 2030 in Anspruch nehmen wird. Der Wagenführer zweifelt daran, dass die Aufsichtsbehörden bis dann grünes Licht erteilen werden. Der Baselbieter, der selbst aus dem Waldenburgertal stammt, hat sich indes entschlossen, auch noch den Führerschein für Autobusse zu erwerben. Damit wäre er bei der BLT flexibel einsetzbar, auf im Fall, dass auf der Strecke der Waldenburgerbahn wegen neuer Bauarbeiten oder Behebung von Störungen Ersatzbusse eingesetzt werden müssten.
Auf dem Weg zum fahrerlosen Betrieb will die BLT in einem weiteren Schritt ab Ende diesen Jahres beim Manövrieren der Fahrzeuge im Depot auf den Einsatz von Fahrpersonal verzichten. Diese befindet sich neben der Endhaltestelle in Waldenburg und wurde ebenfalls neu erbaut.
Die Glogg, der Technologiechef der BLT ausführt, ist der Manövrierbetrieb bei den Wagenführern nicht sonderlich beliebt. Er findet oft spätabends statt, wenn die Fahrzeuge nach dem Einsatz in die Waschanlage gefahren werden müssen. Tagsüber beschränkt sich der damit verbundene Dienst oft auf wenig mehr als eine Stunde. Dies zwingt die Wagenführer, schon nach kurzer Zeit wieder nach Hause zu gehen, wenn sie nicht umgehend im Fahrbetrieb benötigt werden. „Künftig“, sagt Glogg „ werden die Fahrzeuge gewissermaßen frisch gewaschen und geföhnt selbständig das Depot verlassen. Die Wagenführer brauchen in Waldenburg Station nur noch einzusteigen und los geht die Fahrt.“
Aufholbedarf bei Stadler
Mit ihrer Vision, den Betrieb schon bald fahrerlos zu gestalten, erregt die Waldenburgerbahn offenbar weit über die Schweiz hinaus Aufmerksamkeit. „Wir haben seit der Eröffnung vor zweieinhalb Jahren hier schon rund 50 Besuchsdelegationen empfangen, vom europäischen und vom amerikanischen Kontinent“, erzählt Glogg. Nur Asiaten kommen keine. In China gibt es bereits mehrere Großstädte, in denen Metrozüge ohne Fahrer verkehren.
Das rege Interesse kommt dem Schienenfahrzeughersteller Stadler gelegen. Der Konzern hat im Bereich der Signaltechnik, die als deutlich margenträchtiger als das Geschäft mit Rollmaterial gilt, viel Aufholbedarf.
Sadler stieg in diesen Geschäftsbereich erst 2017 ein. Zuvor war das Unternehmen von Peter Spuhler vollständig von Lieferanten der Konkurrenz abhängig gewesen. Der Mitbewerber Alstom und Siemens Mobility bieten Rollmaterial und Signaltechnik seit langem aus einer Hand an. Ein weiterer Komplettanbieter ist das japanische Unternehmen Hitachi.
Im vergangenen Jahr trug die Sparte Signalling bei Stadler erst 2 Prozent zum Gesamtumsatz von 3,3 Milliarden Franken bei. Auch am rekordhohen Auftragsbestand von 29,2 Milliarden Franken hatte der Geschäftsbereich lediglich einen Anteil von 2 Prozent. Zugleich gelang es ihm aber, mit einem Volumen von über einer halben Milliarde Franken 8 Prozent zum konzernweiten Auftragseingang beizusteuern.
Die starke Dynamik im Neugeschäft war in erster Linie einer Großbestellung aus den USA zu verdanken. Der Metrobetreiber der Stadt Atlanta, Marta, beauftragte Stadler damit, für 500 Millionen Dollar sein Zugsicherungssystem zu modernisieren. Das von Stadler entwickelte Produkt im Bereich der kommunikationsbasierten Zugkontrolle wird damit neu nicht nur in Waldenburg, sondern auch in Amerika zum Einsatz gelangen.
Modernisierung am Uetliberg
Dem Geschäftsbereich Signalling von Stadler gelang es 2024 zudem, für einen kleineren Auftrag die Sihltal-Zürich-Uetlibergbahn (SZU) als Kunden zu gewinnen. Stadler setzte sich dabei gegen Siemens Mobility und Hitachi durch. Das Produkt, das die Modernisierung der Sicherungsanlagen auf den Strecken der S 4 und der S 10 sowie neue Stellwerke und Zugbeeinflussungssysteme umfasst, hat ein Volumen von 34 Millionen Franken.
Beim ÖV-Betreiber SZU, der sich ähnlich wie die BLT im Kantons- und Gemeindebesitz befindet, beabsichtigt, bis 2033 800 Millionen bis eine Milliarde Franken in die Modernisierung der Infrastruktur primär im Bahnbetrieb zu investieren. Darin eingeschlossen ist neben der Neugestaltung der beiden SZU-Perrons am Zürcher Hauptbahnhof und dem Ausbau mehrerer Streckenabschnitte von einem auf zwei Gleise auch die Erneuerung des Rollmaterials.
Für die S 10, die auf den Zürcher Hausberg führt, wurden elf Triebzüge zum Gesamtpreis von 110 Millionen Franken beschafft. Weitere 160 Millionen Franken hat die SZU für den Kauf von 17 neuen Triebzügen der S 4 veranschlagt, die das Sihltal befährt. Bei den beiden Ausschreibungen machte ebenfalls Stadler das Rennen.
In Sachen Automatisierung sind die Pläne der SZU aber weniger ambitioniert als das Vorhaben der Waldenburgerbahn. So wird es entlang der Strecken der S 4 und der S 10 im Außenbereich weiterhin Signale geben, welche die Lokführer im Auge behalten müssen. Auch ist kein führerloser Betrieb vorgesehen. „Wir reden eher von Assistenzsystemen“, sagt Mischa Nugent, der Chef der SZU. „Es geht nicht darum, dass unsere Mitarbeiter wegrationalisiert werden, sondern darum, dass sie im täglichen Betrieb eine möglichst gute Unterstützung erhalten.“
Das Management der SZU hofft dank der umfangreichen Investitionen die Pünktlichkeit der beiden Bahnlinien zu verbessern. Wegen Flaschenhälsen bei der Infrastruktur und stark gestiegener Fahrgastzahlen lässt diese seit Jahren zu wünschen übrig.
Das Modernisierungsprogramm, das in den nächsten Jahren angesichts intensiver Bauarbeiten Fahrgästen und Anwohnern viel Geduld abverlangen wird, soll zudem ab ungefähr 2031 die Einführung eines 7,5-Minuten-Takts ermöglichen. Bei der WB geht es zumindest diesbezüglich gemächlicher zu und her. Im Zuge der jüngsten Generalüberholung des Betriebs wurde vom Halb- auf den Viertelstundentakt umgestellt. Höhere Frequenzen b raucht es im weiteren Umland Basels vorläufig nicht.
Die Waldenburgerbahn soll ab 2030 ohne Personal fahren
-
Vielfahrer
- Örtlicher Betriebsleiter
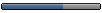
- Beiträge: 4866
- Registriert: So 1. Aug 2010, 13:32
- Wohnort: Tübingen Weststadt