Dieselelektrische Stadler-GTW für den Ringzug?
-
Vielfahrer
- Örtlicher Betriebsleiter
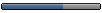
- Beiträge: 4899
- Registriert: So 1. Aug 2010, 13:32
- Wohnort: Tübingen Weststadt
Dieselelektrische Stadler-GTW für den Ringzug?
Hallo,
was haltet ihr davon, wenn man als Nachfolgefahrzeuge für die Ringzug-Regio-Shuttle auf den dieselelektrischen GTW von Stadler setzen würde? Dieser zeichnet sich ja dadurch aus, dass er grundsätzlich elektrisch fährt, aber dort, wo kein Fahrdraht hängt, sich den fehlenden Strom mit einem Dieselmotor erzeugt. Im Ringzuggebiet haben wir ja auf längere Sicht noch Strecken ohne Fahrdraht, etwa zwischen Hintschingen und Zollhaus-Blumberg, zwischen Hüfingen Mitte und Bräunlingen, zwischen Villingen und Rottweil oder Tuttlingen und Immendingen sowie im Donautal. Angenommen, man würde anstatt auf alte 628er gleich auf dieselelektrische Stadler GTW setzen, so könnte man im Ringzuggebiet ein recht perfektes Verkehrsangebot aufziehen, das zu großen Anteilen den Strom aus dem Fahrdraht beziehen könnte (Schwarzwaldbahn, Gäubahn). Anstatt in die Streckeninfrastruktur zu investieren würde man dann in die Fahrzeuginfrastruktur investieren.
Viele Grüße vom Vielfahrer
was haltet ihr davon, wenn man als Nachfolgefahrzeuge für die Ringzug-Regio-Shuttle auf den dieselelektrischen GTW von Stadler setzen würde? Dieser zeichnet sich ja dadurch aus, dass er grundsätzlich elektrisch fährt, aber dort, wo kein Fahrdraht hängt, sich den fehlenden Strom mit einem Dieselmotor erzeugt. Im Ringzuggebiet haben wir ja auf längere Sicht noch Strecken ohne Fahrdraht, etwa zwischen Hintschingen und Zollhaus-Blumberg, zwischen Hüfingen Mitte und Bräunlingen, zwischen Villingen und Rottweil oder Tuttlingen und Immendingen sowie im Donautal. Angenommen, man würde anstatt auf alte 628er gleich auf dieselelektrische Stadler GTW setzen, so könnte man im Ringzuggebiet ein recht perfektes Verkehrsangebot aufziehen, das zu großen Anteilen den Strom aus dem Fahrdraht beziehen könnte (Schwarzwaldbahn, Gäubahn). Anstatt in die Streckeninfrastruktur zu investieren würde man dann in die Fahrzeuginfrastruktur investieren.
Viele Grüße vom Vielfahrer
- KBS720
- Rechte Hand

- Beiträge: 6080
- Registriert: Fr 6. Jul 2007, 12:04
- Wohnort: St.Därge
- Alter: 34
- Kontaktdaten:
Re: Dieselelektrische Stadler-GTW für den Ringzug?
Hallo,
das wäre mal ein guter Kompromiss.
Grüße Andreas
das wäre mal ein guter Kompromiss.
Grüße Andreas
Stinkt und macht en hufe Krach, 218 des isch halt ä Sach
- Tf Reinhard
- Inhaber

- Beiträge: 4990
- Registriert: Do 18. Jan 2007, 16:24
- Alter: 61
Re: Dieselelektrische Stadler-GTW für den Ringzug?
Davon rede ich schon seit Jahren. Noch sind die RS1 aber lange nicht am Ende ihrer Nutzungsdauer (den aktuellen Zustand mal nicht berücksichtigt :pfeifen: ). Das Konzept wäre vom Anfang an sinnvoll gewesen.
Reinhard
Reinhard
Ich bn wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich. Manche auch beides.
-
Bm 6/6 18514
- Hemmschuhleger
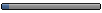
- Beiträge: 365
- Registriert: Sa 12. Apr 2008, 18:54
Re: Dieselelektrische Stadler-GTW für den Ringzug?
Das wäre aber schon eine große Umkonstruktion, in einen normalen GTW dürfte diesel+elektrische Ausrüstung kaum Platz haben (zumindest wenn man mehr als einen Hilfsmotor einbauen will). Schon alleine wegen der erlaubten Achslast wird man sich wohl zwischen Dieselmotoren und Transformator entscheiden müssen.
Stadler kann natürlich viel bauen, z.B. ein Vierachsiger Antriebscontainer (ähnliches baut Stadler auch schmalspurig, dann aber flach mit Sitzplätzen darüber).
Wenn man mindestens dreiteilige Züge kauft, kann man auch einen zweiten Antriebscontainer mit dem Dieselmotor ans zweite Gelenk des GTW setzen mit etwas kürzerem Kasten wie beim ursprüngliche geplanten GTW 4/8.
So ähnlich wie man es beim FLIRT macht, dort ist der Dieselantrieb auch in einem zusätzlichen kurzen Extrawagen.
Florian
Stadler kann natürlich viel bauen, z.B. ein Vierachsiger Antriebscontainer (ähnliches baut Stadler auch schmalspurig, dann aber flach mit Sitzplätzen darüber).
Wenn man mindestens dreiteilige Züge kauft, kann man auch einen zweiten Antriebscontainer mit dem Dieselmotor ans zweite Gelenk des GTW setzen mit etwas kürzerem Kasten wie beim ursprüngliche geplanten GTW 4/8.
So ähnlich wie man es beim FLIRT macht, dort ist der Dieselantrieb auch in einem zusätzlichen kurzen Extrawagen.
Florian
- Hannes
- Weichensteller
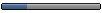
- Beiträge: 1083
- Registriert: Di 11. Mär 2008, 22:50
- Alter: 35
Re: Dieselelektrische Stadler-GTW für den Ringzug?
Ich halte das aus den von Florian genannten Gründen auch eher für unwahrscheinlich. Schon die Kosten für einen zweiten Antriebscontainer dürften nicht ohne sein, zudem fährt man natürlich dann auch oftmals viel Luft durch die Gegend. Die Franzosen haben ja solche Zweikrafttriebwagen, ich meine aber, das wären größere Kisten und daher für den Ringzug eher uninteressant.
Abgesehen davon, dass die RS1 jetzt ja erst 10 Jahre alt sind und damit noch etwa 15-20 Jahre fahren können sollten und man Fahrzeugmehrbedarf auch ggf. durch freigesetzte Triebwagen aus anderen Netzen decken könnte.
Wenn es schon Zukunftsmusik sein darf, würde ich mir eher einen rein elektrischen Triebwagen mit Energiespeicher wünschen, um die nicht elektrifizierten Abschnitte zu überwinden und sich auf den mit Oberleitung überspannten Abschnitten und bei Wendepausen durch eine stationäre Lösung wieder aufzuladen. Problematisch dürfte aber der Energieverbrauch von Klima und co. sein, der wenig Raum lassen wird, um noch ordentlich die Akkus aufzuladen. Was anderes wären dann natürlich noch an Knotenbahnhöfen fest installierte automatische Akkutauschsysteme, denn eig. bietet sich die Eisenbahn mit ihrer Bewegung in nur einer Dimension dafür ja recht gut an, muss man nur genau bremsen, was ja in den meisten Situationen gelingen sollte.
Grüße, Hannes
Abgesehen davon, dass die RS1 jetzt ja erst 10 Jahre alt sind und damit noch etwa 15-20 Jahre fahren können sollten und man Fahrzeugmehrbedarf auch ggf. durch freigesetzte Triebwagen aus anderen Netzen decken könnte.
Wenn es schon Zukunftsmusik sein darf, würde ich mir eher einen rein elektrischen Triebwagen mit Energiespeicher wünschen, um die nicht elektrifizierten Abschnitte zu überwinden und sich auf den mit Oberleitung überspannten Abschnitten und bei Wendepausen durch eine stationäre Lösung wieder aufzuladen. Problematisch dürfte aber der Energieverbrauch von Klima und co. sein, der wenig Raum lassen wird, um noch ordentlich die Akkus aufzuladen. Was anderes wären dann natürlich noch an Knotenbahnhöfen fest installierte automatische Akkutauschsysteme, denn eig. bietet sich die Eisenbahn mit ihrer Bewegung in nur einer Dimension dafür ja recht gut an, muss man nur genau bremsen, was ja in den meisten Situationen gelingen sollte.
Grüße, Hannes
"Deutsche siegen im Fußball, aber bei der Bahn ist täglich Cordoba."
ÖBB-Chef Christian Kern in der Kronenzeitung vom 8.11.14
ÖBB-Chef Christian Kern in der Kronenzeitung vom 8.11.14
-
Vielfahrer
- Örtlicher Betriebsleiter
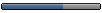
- Beiträge: 4899
- Registriert: So 1. Aug 2010, 13:32
- Wohnort: Tübingen Weststadt
Re: Dieselelektrische Stadler-GTW für den Ringzug?
In der Schweiz wird die Idee mit dieselelektrischen Triebzügen nach wie vor für sinnvoll erachtet. Im Rahmen der Grenzgürtelstrategie ist auf verschiedenen Strecken nördlich der Schweiz, insbesondere zwischen Erzingen und Basel, solch ein Fahrzeug vorteilhaft einsetzbar. Um die diversen wirtschaftlichen Fragen abzuklären, wird gegenwärtig untersucht, welche Investitionen fahrzeugseitig erforderlich würden und mit (voraussichtlich auf deutscher Seite noch Jahrzehnte dauernden) Infrastruktur-Investitionen gegengerechnet werden könnten. Nachdem die Schweiz vollständig elektrifiziert ist, zielt der mögliche Einsatz solcher Fahrzeuge tatsächlich auf den Grenzgürtel ab. Je mehr Fahrzeuge zusammen kämen, umso wirtschaftlicher und damit wahrscheinlicher dürfte der Einsatz von dieselelektrischen Zügen werden.
Wer sich für Details zu diesen Fahrzeugen interessiert, der findet in der Schweizer Eisenbahn-Revue, beginnend ab Heft 10/2013 ab Seite 508 bis 516, in Heft 11/2013 ab Seite 565 bis 570 ausführliche Informationen zu elektrischen und dieselelektrischen Flirt-Triebzügen für Estland. Der Aufsatz wird in der kommenden Ausgabe fortgesetzt. Die Autoren sind Dr.-Ing. Martino Celeghini (Senior Technischer Projektleiter Stadler Bussnang AG) und Dr.-Ing. Florian Menius (Fachverantwortlicher Traktionsausrüstung Stadler Bussnang AG).
Angenommen, die Fahrzeuge würden nur auf der Strecke St. Gallen - Konstanz - Singen - Schaffhausen - Erzingen - Basel gebaut, so würden für einen Stundentakt ca. 6 bis 7 Fahrzeuge benötigt. Für die Bodenseegürtelbahn wären sie aber auch sinnvoll. Zwischen Lindau und Basel könnten dann weitere 6 bis 7 Fahrzeuge eingesetzt werden. Beim Ringzug könnten ebenfalls in ca. 10 bis 15 Jahren mehrere dieselelektrische Fahrzeuge meines Erachtens sinnvoll eingesetzt werden, da etliche Streckenabschnitte nicht elektrifiziert sind, insbesondere die Lücken Immendingen - Tuttlingen und Villingen - Rottweil und Hüfingen Mitte - Bräunlingen (nach erfolger Elektrifizierung der Strecke Neustadt - Donaueschingen).
Ob man dauerhaft damit rechnen kann, dass der 425er der DB auf der Strecke Rottweil - Tuttlingen kapazitätsmäßig aushilft, ist auch fraglich. Weiter sind drei weitere Ringzüge regelmäßig mit über 300 Fahrgästen besetzt, wobei Teile der Zugläufe elektrifiziert sind.
Ich halte deswegen von der Kapazität her größere Fahrzeuge für gar nicht so abwegig. Die dieselelektrischen Triebwagen gibt es bislang in den Versionen zwei-, drei- und vierteilig.
Viele Grüße vom Vielfahrer
Wer sich für Details zu diesen Fahrzeugen interessiert, der findet in der Schweizer Eisenbahn-Revue, beginnend ab Heft 10/2013 ab Seite 508 bis 516, in Heft 11/2013 ab Seite 565 bis 570 ausführliche Informationen zu elektrischen und dieselelektrischen Flirt-Triebzügen für Estland. Der Aufsatz wird in der kommenden Ausgabe fortgesetzt. Die Autoren sind Dr.-Ing. Martino Celeghini (Senior Technischer Projektleiter Stadler Bussnang AG) und Dr.-Ing. Florian Menius (Fachverantwortlicher Traktionsausrüstung Stadler Bussnang AG).
Angenommen, die Fahrzeuge würden nur auf der Strecke St. Gallen - Konstanz - Singen - Schaffhausen - Erzingen - Basel gebaut, so würden für einen Stundentakt ca. 6 bis 7 Fahrzeuge benötigt. Für die Bodenseegürtelbahn wären sie aber auch sinnvoll. Zwischen Lindau und Basel könnten dann weitere 6 bis 7 Fahrzeuge eingesetzt werden. Beim Ringzug könnten ebenfalls in ca. 10 bis 15 Jahren mehrere dieselelektrische Fahrzeuge meines Erachtens sinnvoll eingesetzt werden, da etliche Streckenabschnitte nicht elektrifiziert sind, insbesondere die Lücken Immendingen - Tuttlingen und Villingen - Rottweil und Hüfingen Mitte - Bräunlingen (nach erfolger Elektrifizierung der Strecke Neustadt - Donaueschingen).
Ob man dauerhaft damit rechnen kann, dass der 425er der DB auf der Strecke Rottweil - Tuttlingen kapazitätsmäßig aushilft, ist auch fraglich. Weiter sind drei weitere Ringzüge regelmäßig mit über 300 Fahrgästen besetzt, wobei Teile der Zugläufe elektrifiziert sind.
Ich halte deswegen von der Kapazität her größere Fahrzeuge für gar nicht so abwegig. Die dieselelektrischen Triebwagen gibt es bislang in den Versionen zwei-, drei- und vierteilig.
Viele Grüße vom Vielfahrer
Zuletzt geändert von Vielfahrer am Sa 2. Nov 2013, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
- VT250-BaWü-Express
- Weichenputzer
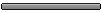
- Beiträge: 130
- Registriert: So 25. Nov 2007, 11:56
- Wohnort: Kiel
- Alter: 45
Re: Dieselelektrische Stadler-GTW für den Ringzug?
Guten Morgen,
ohne jetzt den von Vielfahrer genannten Artikel zu kennen, bezieht sich "dieselelektrisch" bei bisherigen Schienenfahrzeugen darauf, dass der Dieselmotor an einen Generator geht, der das ganze in elektrische Energie umsetzt und an die Elektromotoren weitergibt, die wiederum für den Antrieb sorgen. Diese Bauform ist insofern nichts Neues, wird sie doch schon seit geraumer Zeit auch bei Schienenfahrzeugen in Deutschland eingesetzt. Worüber wir hier eher reden, sind wohl sogenannte Hybridantriebe, wobei mir da in Sachen Eisenbahn keine großen Beispiele bekannt sind, außer einer E-Lok, welche die "letzte Meile" mithilfe eines Hilfsdieselmotors zurücklegen kann ( ich meine es sei die BR 187 von Bombardier).
Mario
ohne jetzt den von Vielfahrer genannten Artikel zu kennen, bezieht sich "dieselelektrisch" bei bisherigen Schienenfahrzeugen darauf, dass der Dieselmotor an einen Generator geht, der das ganze in elektrische Energie umsetzt und an die Elektromotoren weitergibt, die wiederum für den Antrieb sorgen. Diese Bauform ist insofern nichts Neues, wird sie doch schon seit geraumer Zeit auch bei Schienenfahrzeugen in Deutschland eingesetzt. Worüber wir hier eher reden, sind wohl sogenannte Hybridantriebe, wobei mir da in Sachen Eisenbahn keine großen Beispiele bekannt sind, außer einer E-Lok, welche die "letzte Meile" mithilfe eines Hilfsdieselmotors zurücklegen kann ( ich meine es sei die BR 187 von Bombardier).
Mario
-
Bm 6/6 18514
- Hemmschuhleger
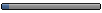
- Beiträge: 365
- Registriert: Sa 12. Apr 2008, 18:54
Re: Dieselelektrische Stadler-GTW für den Ringzug?
Es gibt Überlegungen einiger Politiker für die Hybridfahrzeuge, bei einer genaueren Prüfung werden diese Überlegungen aber wohl im Papierkorb landen (hoffentlich).
Ein durchgehender Zug St. Gallen-Konstanz hat nur einen eher geringen Nutzen. Entstanden ist die Idee dadurch, dass bei einer Elektrifizierung Erzingen-Basel die Züge nach Friedrichshafen in Singen gebrochen werden müssen. Zudem will/wollte man die Züge um 15 min verschieben (entsprechend lange Umsteigezeit in Singen statt heute durchgehende IRE).
Umgekehrt hat der neue (ab 2015) RE St. Gallen-Konstanz bei einer Drehung der Seelinie ab 2018 keinen Anschluss mehr an den Schwarzwaldzug nach Singen. Da gibt es die Idee, den Zug aus St. Gallen nach Singen durchzubinden. Nur wer den zweiten RE pro Stunde im 15 min-Abstand zum Schwarzwald-Zug bezahlen soll, wenn man sich heute nicht mal einen durchgehenden Stundentakt im Schwarzwald oder nach Basel leisten kann/will, ist eine sehr gute Frage. Davon abgesehen, dass es wohl problematisch für Seehas/Seehäsle-Fahrzeiten wäre.
Die Elektrozüge aus Basel und St. Gallen hätten dann je nach Fahrplanlage gleichzeitig in Singen gewendet. In diesem Fall wäre eine Durchbindung natürlich sinnvoll gewesen, da dem zwar nur geringen Nutzen eben auch nur ein sehr geringer Aufwand gegenüber gestanden hätte.
Nur ist die Grundlage für die Durchbindung inzwischen eigentlich komplett weggefallen:
-keine Elektrotriebwagen nach Basel möglich
-teure Spezialentwicklung für Hybridfahrzeuge nötig
-Fahrzeitverlängerung wegen der Hybridfahrzeuge, der Witz an der Elektrifizierung nach Basel war ja die viele höhere Leistung der Elektrotriebwagen, die die Fahrzeit der Dieselneigezüge fast halten könnten. Wenn man aber mit einem ebenfalls nur schwach motorisierten Hybrid-Zug von Erzingen nach Basel fährt, ist der Fahrzeitunterschied zum Neigezug deutlich grössere
-höhere Betriebskosten da Zug schwerer und unterhaltsaufwendiger
-Brechung der wichtigeren Durchbindung nach Friedrichshafen
Gerade den letzten Punkt finde ich sehr bedeutend, bei einer Elektrifizierung hätten die Züge in Singen gebrochen werden müssen. Die endenden Züge stattdessen nach St. Gallen durchbinden ist da sinnvoll. Ohne Elektrifizierung spricht aber nichts dagegen, mit dem Dieselzug (611 oder 612) weiter durchgehend nach Basel zu fahren. Hier dürfte deutlich mehr Nachfrage sein als bei der "Notlösung" nach St. Gallen.
Wenn könnte man also nur die bisher in Singen enden Züge des nicht durchgehenden Stundentakts nach St. Gallen verlängern, und dann wird es sehr unwirtschaftlich, da die Serie an Spezialfahrzeugen immer kleiner wird und die Umläufe sehr schlecht (sehr lange Wendezeiten in Basel für beide Fahrzeugtypen und in Singen). Zudem wäre ein einigermassen exakter Stundentakt nach Basel nicht mehr möglich.
Die bessere Lösung ohne Elektrifizierung wäre daher in meinen Augen, die IRE Basel-Friedrichshafen-Ulm/Lindau so zu lassen wie sie sind und einen durchgehenden Stundentakt Basel-Singen auch abends und am Wochenende, ebenfalls mit 611/612.
Wenn man dann etwas verbessern will, kann man den (zeitweisen) Halbstundentakt Basel-Schaffhausen einführen, mit Anschluss an den Gäubahn-IC dort (dieser IC verhindert einen durchgehenden Halbstundentakt nach Singen).
St. Gallen hat damit keine Nachteile (die sind nach Schaffhausen/Basel sowieso schneller via Schweiz und nach Singen ändert sich nichts), Ab Romanshorn/Kreuzlingen Hafen/Konstanz muss man einmal mehr nach Schaffhausen-Basel umsteigen, aber dafür muss man ab München/Lindau/Ulm/Friedrichshafen/etc. einmal weniger umsteigen, was in meinen Augen wichtiger ist.
Florian
Ein durchgehender Zug St. Gallen-Konstanz hat nur einen eher geringen Nutzen. Entstanden ist die Idee dadurch, dass bei einer Elektrifizierung Erzingen-Basel die Züge nach Friedrichshafen in Singen gebrochen werden müssen. Zudem will/wollte man die Züge um 15 min verschieben (entsprechend lange Umsteigezeit in Singen statt heute durchgehende IRE).
Umgekehrt hat der neue (ab 2015) RE St. Gallen-Konstanz bei einer Drehung der Seelinie ab 2018 keinen Anschluss mehr an den Schwarzwaldzug nach Singen. Da gibt es die Idee, den Zug aus St. Gallen nach Singen durchzubinden. Nur wer den zweiten RE pro Stunde im 15 min-Abstand zum Schwarzwald-Zug bezahlen soll, wenn man sich heute nicht mal einen durchgehenden Stundentakt im Schwarzwald oder nach Basel leisten kann/will, ist eine sehr gute Frage. Davon abgesehen, dass es wohl problematisch für Seehas/Seehäsle-Fahrzeiten wäre.
Die Elektrozüge aus Basel und St. Gallen hätten dann je nach Fahrplanlage gleichzeitig in Singen gewendet. In diesem Fall wäre eine Durchbindung natürlich sinnvoll gewesen, da dem zwar nur geringen Nutzen eben auch nur ein sehr geringer Aufwand gegenüber gestanden hätte.
Nur ist die Grundlage für die Durchbindung inzwischen eigentlich komplett weggefallen:
-keine Elektrotriebwagen nach Basel möglich
-teure Spezialentwicklung für Hybridfahrzeuge nötig
-Fahrzeitverlängerung wegen der Hybridfahrzeuge, der Witz an der Elektrifizierung nach Basel war ja die viele höhere Leistung der Elektrotriebwagen, die die Fahrzeit der Dieselneigezüge fast halten könnten. Wenn man aber mit einem ebenfalls nur schwach motorisierten Hybrid-Zug von Erzingen nach Basel fährt, ist der Fahrzeitunterschied zum Neigezug deutlich grössere
-höhere Betriebskosten da Zug schwerer und unterhaltsaufwendiger
-Brechung der wichtigeren Durchbindung nach Friedrichshafen
Gerade den letzten Punkt finde ich sehr bedeutend, bei einer Elektrifizierung hätten die Züge in Singen gebrochen werden müssen. Die endenden Züge stattdessen nach St. Gallen durchbinden ist da sinnvoll. Ohne Elektrifizierung spricht aber nichts dagegen, mit dem Dieselzug (611 oder 612) weiter durchgehend nach Basel zu fahren. Hier dürfte deutlich mehr Nachfrage sein als bei der "Notlösung" nach St. Gallen.
Wenn könnte man also nur die bisher in Singen enden Züge des nicht durchgehenden Stundentakts nach St. Gallen verlängern, und dann wird es sehr unwirtschaftlich, da die Serie an Spezialfahrzeugen immer kleiner wird und die Umläufe sehr schlecht (sehr lange Wendezeiten in Basel für beide Fahrzeugtypen und in Singen). Zudem wäre ein einigermassen exakter Stundentakt nach Basel nicht mehr möglich.
Die bessere Lösung ohne Elektrifizierung wäre daher in meinen Augen, die IRE Basel-Friedrichshafen-Ulm/Lindau so zu lassen wie sie sind und einen durchgehenden Stundentakt Basel-Singen auch abends und am Wochenende, ebenfalls mit 611/612.
Wenn man dann etwas verbessern will, kann man den (zeitweisen) Halbstundentakt Basel-Schaffhausen einführen, mit Anschluss an den Gäubahn-IC dort (dieser IC verhindert einen durchgehenden Halbstundentakt nach Singen).
St. Gallen hat damit keine Nachteile (die sind nach Schaffhausen/Basel sowieso schneller via Schweiz und nach Singen ändert sich nichts), Ab Romanshorn/Kreuzlingen Hafen/Konstanz muss man einmal mehr nach Schaffhausen-Basel umsteigen, aber dafür muss man ab München/Lindau/Ulm/Friedrichshafen/etc. einmal weniger umsteigen, was in meinen Augen wichtiger ist.
Florian
-
Vielfahrer
- Örtlicher Betriebsleiter
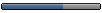
- Beiträge: 4899
- Registriert: So 1. Aug 2010, 13:32
- Wohnort: Tübingen Weststadt
Re: Dieselelektrische Stadler-GTW für den Ringzug?
Hallo,
die ostschweizer Spangenlösung sieht vor, in Singen den Gäubahn-IC zur halben Stunde nach Stuttgart /von Stuttgart stündlich zu erreichen. Davon profitiert insbesondere die Gäubahn, weil sie dann stündliche Anschlüsse aus/nach St. Gallen und aus/nach Waldshut - Basel hat. Der Schaden, den der Interimsfahrplan (der hinsichtlich der Abfahrtzeit in Zürich sicherlich ein Dauerfahrplan werden dürfte) angerichtet hat, wäre im Knoten Singen behoben. Unabhängig davon kann man den RE Lindau (nicht mehr Ulm nach Elektrifizierung der Südbahn) in seiner bisherigen Fahrlage erhalten, was einen 30-Minuten-Takt zwischen Radolfzell und Basel durch Überlagerung des IRE mit dem Spangenzug ergäbe. Die Schwarzwaldbahn wird nach meinem Kenntnisstand im Singener Nullknoten bleiben. Jeweils zwischen Schwarzwaldbahn und Spangenzug würde halbstündlich der Seehas verkehren können. Zwischen Singen und Konstanz wäre dies auf der Höri ein perfektes Verkehrsangebot.
Auf der Bodenseegürtelbahn hat sich die Region Bodensee-Oberschwaben und der Landkreis Friedrichshafen überlegt, welches Fahrplanangebot längerfristig sinnvoll wäre. Die Bodenseegürtelbahn hängt ja zwischen der Südbahn und dem Knoten Singen. Beide Partner sind zum Schluss gekommen, dass der Kundennutzen am größten wäre, wenn alle 30 Minuten eine RB zwischen Friedrichshafen und Singen verkehren würde. Bei einem 30-Minuten-Takt könnte man nämlich die Infrastruktur optimieren und sich dann mit jeweils verträglichen Umstiegszeiten an nahezu jede Knotensituation in Singen bzw. Friedrichshafen leicht anpassen. Will man aber einen attraktiven Nahverkehr (Stichwort Bodensee-S-Bahn) abwickeln und muss den zweistündlichen IRE berücksichtigen, so ergeben sich höchst problematische Infrastrukturnotwendigkeiten bzw. der Fahrplan wird ziemlich starr bei begrenztem (weil nur zweistündlichem) Nutzen für die überregionalen Verbindungen. Dies trifft auch auf den Abschnitt Friedrichshafen - Lindau (Reutin/Hbf) zu. Der Ansatz des Bodenseekreises ist daher zumindest nachvollziehbar, wenn man berücksichtigt, dass das Bodenseeufer sehr dichte Besiedelung aufweist.
Ich finde es daher erst einmal gut, dass sich die Schweizer überlegen (sie sprechen sich ja nicht gegen die Elektrifizierung aus), wie man möglichst schnell im Grenzgebiet zu attraktiveren Verbindungen kommt. Ob man dabei den IRE mit den 611ern als attraktiv bezeichnen kann, ist zumindest umstritten. Ich erinnere mich an Zeitungsberichte, denen zufolge Fahrgäste auf der Hochrheinstrecke nur noch auf den Toiletten Platz hatten oder an eigene Erfahrungen, wo mir selbst von DB-Seite abgeraten wurde, auf den IRE zu warten, wenn ich in Basel Bad Bf einen ICE-Anschluss nach Freiburg - Karlsruhe erreichen wollte.
Aus Schweizer Sicht sind die Verbindungen zwischen Winterthur und Zürich sowie auch zwischen Schaffhausen und Zürich eher überlastet. In den Protokollen zur Parlamentsdebatte kann man nachlesen, dass u.a. gerade deshalb die Spangenlösung gefordert wird, weil sie den Verkehrsknoten Zürich entlastet.
Sicherlich wäre es vorzuziehen, wenn die Hochrheinstrecke rasch und vollständig elektrifiziert würde, ebenso die Bodenseegürtelbahn. Aber darauf deutet leider gar nichts hin. Es kommen die weiteren Infrastrukturmängel hinzu. Abgebaute Kreuzung in Tiengen, nur eine Bahnsteigkante in Lauchringen, viel zu niedrige Bahnsteige z.B. in Radolfzell-Böhringen usw. Die Schweiz hat es nach meinem Kenntnisstand definitiv abgelehnt, sich an den Elektrifizierungskosten zu beteiligen. Wohl aber wäre aus Schweizer Sicht vorstellbar, mit dieselelektrischen Fahrzeugen das Verkehrsangebot jetzt (d.h. ab ca. 2017) zu verdichten. So jedenfalls habe ich das den Worten des Schaffhausener "Verkehrsministers" Reto Dubach beim 150-Jahr-Jubiläum der Strecke Waldshut - Konstanz und auch dem Beitrag von Herrn Fügistaler vom BAV in Bern bei der Einweihung der Doppelspur und der Elektrifizierung Schaffhausen - Erzingen im Festzelt in Neunkirch entnommen. Das wäre einerseits eine Förderung für die schweizerischen Fahrzeughersteller und würde andererseits der SBB ermöglichen, auf der Spange auch mit eigenen Fahrzeugen zu fahren. Dieseltriebwagen mit oder ohne Neigetechnik wird sich die Schweiz ja wohl kaum zulegen wollen. Verkehrsminister Hermann musste im Gegensatz dazu bei der Veranstaltung in Radolfzell sagen, dass er nichts mitgebracht hätte (was aber nicht seine Schuld war). Es blieb ihm wenig anderes übrig, als zu berichten, dass unsere Vorfahren die Strecke Mannheim - Basel in 25 Jahren gebaut hätten, während wir heutzutage in 25 Jahren immer noch an der Planung wären und lediglich auf einem Drittel der Strecke das 3. und 4. Gleis liegen würde.
Bleibt die berechtigte Frage, wer einen "30-Minuten-Takt" im Abschnitt Radolfzell - Basel mit RE/IRE-Zügen bestellt. Nachdem die Züge teilweise brechend voll sind, muss da über die Einnahmeseite viel gehen. Es kann ja nicht angehen, dass auf Dauer die Verbünde mit dem Festhalten an Alteinnahme-Strukturen zu einer Einnahme-Umverteilungs-Einrichtung mutieren. Derjenige, der befördert, der soll auch die entsprechenden Fahrgeldanteile bekommen. Vielleicht ist auch eine ähnliche Lösung wie bei der Gäubahn denkbar, die aufkommensbasierte Zuschüsse (Tarifausgleiche) als Finanzierungsbasis für einen ansonsten eigenwirtschaftlichen Verkehr hat.
Viele Grüße vom Vielfahrer
die ostschweizer Spangenlösung sieht vor, in Singen den Gäubahn-IC zur halben Stunde nach Stuttgart /von Stuttgart stündlich zu erreichen. Davon profitiert insbesondere die Gäubahn, weil sie dann stündliche Anschlüsse aus/nach St. Gallen und aus/nach Waldshut - Basel hat. Der Schaden, den der Interimsfahrplan (der hinsichtlich der Abfahrtzeit in Zürich sicherlich ein Dauerfahrplan werden dürfte) angerichtet hat, wäre im Knoten Singen behoben. Unabhängig davon kann man den RE Lindau (nicht mehr Ulm nach Elektrifizierung der Südbahn) in seiner bisherigen Fahrlage erhalten, was einen 30-Minuten-Takt zwischen Radolfzell und Basel durch Überlagerung des IRE mit dem Spangenzug ergäbe. Die Schwarzwaldbahn wird nach meinem Kenntnisstand im Singener Nullknoten bleiben. Jeweils zwischen Schwarzwaldbahn und Spangenzug würde halbstündlich der Seehas verkehren können. Zwischen Singen und Konstanz wäre dies auf der Höri ein perfektes Verkehrsangebot.
Auf der Bodenseegürtelbahn hat sich die Region Bodensee-Oberschwaben und der Landkreis Friedrichshafen überlegt, welches Fahrplanangebot längerfristig sinnvoll wäre. Die Bodenseegürtelbahn hängt ja zwischen der Südbahn und dem Knoten Singen. Beide Partner sind zum Schluss gekommen, dass der Kundennutzen am größten wäre, wenn alle 30 Minuten eine RB zwischen Friedrichshafen und Singen verkehren würde. Bei einem 30-Minuten-Takt könnte man nämlich die Infrastruktur optimieren und sich dann mit jeweils verträglichen Umstiegszeiten an nahezu jede Knotensituation in Singen bzw. Friedrichshafen leicht anpassen. Will man aber einen attraktiven Nahverkehr (Stichwort Bodensee-S-Bahn) abwickeln und muss den zweistündlichen IRE berücksichtigen, so ergeben sich höchst problematische Infrastrukturnotwendigkeiten bzw. der Fahrplan wird ziemlich starr bei begrenztem (weil nur zweistündlichem) Nutzen für die überregionalen Verbindungen. Dies trifft auch auf den Abschnitt Friedrichshafen - Lindau (Reutin/Hbf) zu. Der Ansatz des Bodenseekreises ist daher zumindest nachvollziehbar, wenn man berücksichtigt, dass das Bodenseeufer sehr dichte Besiedelung aufweist.
Ich finde es daher erst einmal gut, dass sich die Schweizer überlegen (sie sprechen sich ja nicht gegen die Elektrifizierung aus), wie man möglichst schnell im Grenzgebiet zu attraktiveren Verbindungen kommt. Ob man dabei den IRE mit den 611ern als attraktiv bezeichnen kann, ist zumindest umstritten. Ich erinnere mich an Zeitungsberichte, denen zufolge Fahrgäste auf der Hochrheinstrecke nur noch auf den Toiletten Platz hatten oder an eigene Erfahrungen, wo mir selbst von DB-Seite abgeraten wurde, auf den IRE zu warten, wenn ich in Basel Bad Bf einen ICE-Anschluss nach Freiburg - Karlsruhe erreichen wollte.
Aus Schweizer Sicht sind die Verbindungen zwischen Winterthur und Zürich sowie auch zwischen Schaffhausen und Zürich eher überlastet. In den Protokollen zur Parlamentsdebatte kann man nachlesen, dass u.a. gerade deshalb die Spangenlösung gefordert wird, weil sie den Verkehrsknoten Zürich entlastet.
Sicherlich wäre es vorzuziehen, wenn die Hochrheinstrecke rasch und vollständig elektrifiziert würde, ebenso die Bodenseegürtelbahn. Aber darauf deutet leider gar nichts hin. Es kommen die weiteren Infrastrukturmängel hinzu. Abgebaute Kreuzung in Tiengen, nur eine Bahnsteigkante in Lauchringen, viel zu niedrige Bahnsteige z.B. in Radolfzell-Böhringen usw. Die Schweiz hat es nach meinem Kenntnisstand definitiv abgelehnt, sich an den Elektrifizierungskosten zu beteiligen. Wohl aber wäre aus Schweizer Sicht vorstellbar, mit dieselelektrischen Fahrzeugen das Verkehrsangebot jetzt (d.h. ab ca. 2017) zu verdichten. So jedenfalls habe ich das den Worten des Schaffhausener "Verkehrsministers" Reto Dubach beim 150-Jahr-Jubiläum der Strecke Waldshut - Konstanz und auch dem Beitrag von Herrn Fügistaler vom BAV in Bern bei der Einweihung der Doppelspur und der Elektrifizierung Schaffhausen - Erzingen im Festzelt in Neunkirch entnommen. Das wäre einerseits eine Förderung für die schweizerischen Fahrzeughersteller und würde andererseits der SBB ermöglichen, auf der Spange auch mit eigenen Fahrzeugen zu fahren. Dieseltriebwagen mit oder ohne Neigetechnik wird sich die Schweiz ja wohl kaum zulegen wollen. Verkehrsminister Hermann musste im Gegensatz dazu bei der Veranstaltung in Radolfzell sagen, dass er nichts mitgebracht hätte (was aber nicht seine Schuld war). Es blieb ihm wenig anderes übrig, als zu berichten, dass unsere Vorfahren die Strecke Mannheim - Basel in 25 Jahren gebaut hätten, während wir heutzutage in 25 Jahren immer noch an der Planung wären und lediglich auf einem Drittel der Strecke das 3. und 4. Gleis liegen würde.
Bleibt die berechtigte Frage, wer einen "30-Minuten-Takt" im Abschnitt Radolfzell - Basel mit RE/IRE-Zügen bestellt. Nachdem die Züge teilweise brechend voll sind, muss da über die Einnahmeseite viel gehen. Es kann ja nicht angehen, dass auf Dauer die Verbünde mit dem Festhalten an Alteinnahme-Strukturen zu einer Einnahme-Umverteilungs-Einrichtung mutieren. Derjenige, der befördert, der soll auch die entsprechenden Fahrgeldanteile bekommen. Vielleicht ist auch eine ähnliche Lösung wie bei der Gäubahn denkbar, die aufkommensbasierte Zuschüsse (Tarifausgleiche) als Finanzierungsbasis für einen ansonsten eigenwirtschaftlichen Verkehr hat.
Viele Grüße vom Vielfahrer
-
wolfgang65
- Rangierhelfer
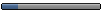
- Beiträge: 793
- Registriert: Di 8. Jan 2008, 20:58
- Wohnort: Villingen
Re: Dieselelektrische Stadler-GTW für den Ringzug?
Hallo Vielfahrer,
ein dieselelektrischer Triebwagen ist nicht anderes wie ein Dieseltriebwagen. Ein Fahrzeug das unter 15kV und mit eigenem Dieselmotor fahren kann, läuft derzeit unter dem Begriff Hybrid. Dieser ist allerdings auch nicht wirklich spezifisch für diese Technik, da Hybrid alles mögliche bedeuten kann.
Was meinst Du jetzt wirklich?
Technisch gesehen hat übrigens ein 15kV + Diesel Hybrid Fahrzeug nur bedingt etwas mit einem dieselelektrischen Fahrzeug zu tun. Der komplette Hochspannungsteil - der ja viel Platz benötigt - ist ja hier nicht vorhanden. Übrigens sind Hybrid-Straßenbahnen, wie die Combino Duos im Harz deutlich einfacher aufgebaut. Die taugen nicht für 15kV...
Grüße
Wolfgang
ein dieselelektrischer Triebwagen ist nicht anderes wie ein Dieseltriebwagen. Ein Fahrzeug das unter 15kV und mit eigenem Dieselmotor fahren kann, läuft derzeit unter dem Begriff Hybrid. Dieser ist allerdings auch nicht wirklich spezifisch für diese Technik, da Hybrid alles mögliche bedeuten kann.
Was meinst Du jetzt wirklich?
Technisch gesehen hat übrigens ein 15kV + Diesel Hybrid Fahrzeug nur bedingt etwas mit einem dieselelektrischen Fahrzeug zu tun. Der komplette Hochspannungsteil - der ja viel Platz benötigt - ist ja hier nicht vorhanden. Übrigens sind Hybrid-Straßenbahnen, wie die Combino Duos im Harz deutlich einfacher aufgebaut. Die taugen nicht für 15kV...
Grüße
Wolfgang